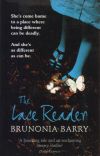Juni 2012
Werte Lesende!
In diesem Monat standen Großbritannien und die USA offenbar ganz besonders im Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit – aber lest selbst!
 Bill Bryson: I’m a Stranger Here Myself (auch: Notes from a Big Country). 1999.
Bill Bryson: I’m a Stranger Here Myself (auch: Notes from a Big Country). 1999.
Wayne Grady / Merilyn Simonds: Breakfast at the Exit Cafe. 2010.
Diese beiden Bücher habe ich quasi parallel gelesen, und das ist wirklich spannend gewesen.
Zu den Büchern: Der US-Amerikaner Bryson beschreibt in seinen (gesammelten) Kolumnen, wie er nach zwanzig Jahren England mit seiner englischen Familie in die USA zurückkehrt und was ihm da jetzt so auffällt. Er lebt in einem idyllischen Örtchen in Maine, kommt aber natürlich reichlich rum. Das ist voll des trockenen und/oder slapstickhaften Humors Brysonscher Prägung, aber auch oft nachdenkenswert.
Kontrast/Ergänzung bilden das kanadische Paar Grady und Simonds mit ihrer US-Reise und ihren Beobachtungen, wie sie sich im großen Nachbar fühlen. Ihnen fällt vieles von dem auf, was auch Bryson anmerkt, selbst wenn sie grundsätzlich etwas philosophischer und weniger auf die Pointe hin an die Sache herangehen. (Es gibt noch keine deutschsprachige Übersetzung.)
Und noch reizvoller dazu ist ein weiteres Buch, das ich aber gerade erst angelesen habe (ich kenne es jedoch von GANZ früher): Der Stern von Kalifornien (1976) von Hans-Otto Meißner, ein Deutscher, der in seinem Buch eine einzige Hymne auf die USA und Kalifornien singt … aber die Zeit, die Zeit.
Ich gucke ja auch gern auf Karten oder in Reiseführern, wo die Leut unterwegs sind, und das Internet bietet heutzutage noch ganz andere Möglichkeiten. So habe ich die Hotels angesehen, in denen Grady/Simonds nächtigen (sofern sie den Namen nennen), und es gibt Fotos von Straßen und Bauwerken und Gegend. Sehr anrührend auch, daß sie in Seattle in demselben Buchladen stehen wie ich 1996 und dasselbe sehen. Und im Covered Market war ich auch, ich hab auch den eingegrabenen VW-Käfer gesehen. Aber Europäer sehen in den USA eigentlich andere Dinge, auch andere als “Exil”-US-Bürger oder Kanadier.
Deutschsprachige Ausgabe:
Bill Bryson: Streiflichter aus Amerika. Übersetzt von Sigrid Ruschmeier. Goldmann, 2000.
 Mary Stewart: The Stormy Petrel. 1991.
Mary Stewart: The Stormy Petrel. 1991.
Wenn die Welt schlecht oder verregnet oder dunkel ist und man sich beim Griff zum Krimi davor fürchten muß, knietief in Gedärmen zu waten, und alles andere entweder zu kompliziert oder zu sonstwas ist, dann ist die Zeit gekommen, ein Buch von Mary Stewart wiederzulesen. Dieses kannte ich übrigens noch gar nicht, obwohl es schon länger auf meinen Regalen rumsteht. Die Stewart, das sagte ich neulich schon mal, schrieb romantic thriller mit einem für die 1960/70er sehr modernen bzw. geradezu feministischen Touch. Und trotzdem: es bleiben romantic thriller. Was sie sonst noch sehr gut kann, ist spannend schreiben und sehr schön die Landschaft mit Worten abbilden.
Zum Buch: Hier folgt sie einer Schriftstellerin auf eine (fiktive!) Insel der Inneren Hebriden. Der junge Frau schneien schon in der Nacht zwei sehr verschiedene Männer ins Cottage, und auch wenn diesmal bald klar ist, welchen sie nehmen wird, gibt es durchaus genug Spannung. Bei aller Liebe zu Stewart und sehr schönen Passagen in diesem Buch möchte ich es doch zu einem ihrer schwächeren rechnen. Zeitverschwendung ist es allerdings nicht!
Deutschsprachige Ausgabe:
Mary Stewart: Wie ein Vogel im Sturm. Übersetzt von Fred Schmitz. Heyne, 1996. (Auch als Buchclubausgabe unter dem Titel Geheimnisvolle Gäste.)
Patricia Wentworth: Lonesome Road. 1939.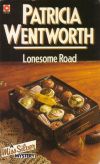
Das ist der dritte Miss-Silver-Roman von insgesamt 31, die sich eigentlich qualitativ kaum unterscheiden. Daß die Zeit zwischen den Bänden überhaupt vergeht, merkt man höchstens daran, ob noch Lebensmittelcoupons verwendet werden oder für wessen Babies/Kinder Miss Silver diesmal strickt. Typisch für die Miss-Silver-Krimis (von den anderen Wentworth-Krimis habe ich noch keinen gelesen, die sind schwer zu finden) ist auch, daß es meist eine romantische Nebenhandlung gibt, aber insgesamt sind die Bücher doch eher Krimi als romantic thriller, und sie sind fürchterlich englisch. Miss Silver sieht man eher selten ermitteln, sie macht das im Hintergrund, und wir erfahren auch höchstens ihre Handlungen, nicht aber ihre Überlegungen.
Zum Buch: Rachel Treherne verwaltet das riesige Erbe ihres Vaters. Da sie von ihren Verwandten darum beneidet wird, ist es auch kaum verwunderlich, daß Mordanschläge auf sie verübt werden, und sie zieht Miss Silver als diskrete Ermittlerin hinzu. Was die Familie – die sich bei Rachel unangenehm oft und lange als Hausgast einnistet und sich dabei ziemlich ungastlich aufführt – nicht weiß, ist, daß der Vater Rachel aufgetragen hat, den Sohn seines ehemaligen amerikanischen Kompagnons ausfindig zu machen und zu entschädigen. Der Showdown findet mit einem wirklich perfiden Anschlag in einem uralten Bauernhaus statt.
Deutschsprachige Ausgabe:
Patricia Wentworth: Der Stoß von der Klippe. Übersetzt von Elfi Hartenstein. Goldmann, 2002.
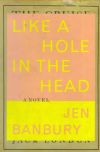 Jen Banbury: Like a Hole in the Head. 1998.
Jen Banbury: Like a Hole in the Head. 1998.
Nach diesem Buch habe ich ziemlich lange gefahndet, weil ich gelesen hatte, daß es darin um alte Bücher, Büchersammler und eine recht durchgeknallte Heldin gehen sollte. Nun habe ich sogar eine Erstausgabe ergattert!
Zum Buch: Ähnliches passiert Jill, die in einem Antiquariat in Los Angeles für den meist abwesenden Besitzer den Schreibtischstuhl warm hält, die Katze füttert und hin und wieder tatsächlich ein Buch verkauft. Ansonsten lebt sie eher in den Tag hinein. Eines Tages wird ihr für ein paar lumpige Dollar The Cruise of the Snark von Jack London angeboten, in einer für einen Freund signierten Erstausgabe. Und sogleich verkauft sie es unter der Hand weiter an einen anderen Antiquar. Daß das ein Fehler war, macht ihr wenig später ein unsympathisch wirkender Schlägertyp klar – es war alles ein Mißverständnis, sein Boß will das Buch zurück, aber pronto, sonst -! Unnötig zu erwähnen, daß Jill das Buch trotz hohen Körpereinsatzes erst mal nicht zurückbekommt, auch ein Motorradtrip nach Las Vegas bringt sie nur wenig voran. Dafür erleidet sie eine Reihe von Blessuren, teilt auch ordentlich aus, lernt eine Menge netter und nicht netter Menschen kennen, kriegt das Buch und verliert es wieder, landet beim Film … kurzum, eher eine Art Hard-boiled-Roadmovie mit Slapstickeinlagen.
Und während das Buch (nicht nur im Roman) echt ist, ist seine Besonderheit (im Roman), die es für Sammler unwiderstehlich macht, erfunden: Ein Buchbinder namens Grautzweller hat in jeder Auflage der von ihm gebundenen Bücher einige Seiten so vertauscht, daß die ersten Buchstaben darauf eine kodierte Nachricht in Gedichtform bilden. Leider gibt der Roman kein konkretes Beispiel dafür!
Deutschsprachige Ausgabe:
Jan Banbury: Von einer, die auszog. Übersetzt von Kim Schwaner. Rowohlt, 2001.
 Dick Francis: Come to Grief. 1995. / To the Hilt. 1996.
Dick Francis: Come to Grief. 1995. / To the Hilt. 1996.
Ich habe vergessen, wer es gesagt hat, aber es war jemand Berühmtes: Nämlich daß sie (oder er?) sich jedes Jahr auf den neuesten Dick Francis freut und gespannt ist, wie er diesmal das Thema Pferd eingebaut hat.
Zu den Büchern: In Come to Grief hat der Ex-Jockey und Jetzt-Privatdetektiv Sid Halley (der nur einen Arm hat dank eines fiesen Reitunfalls) den unangenehmen Job, einen seiner besten Freunde vor Gericht zu bringen. Der Freund hat Dinge getan, die eine Freundschaft nicht mehr aushalten kann. Ich gehe nicht weiter in die Details; es ist ein für Francis sehr finsteres Buch, und dabei ist er ja auch sonst nicht zimperlich mit dem, was er seine Helden durchleben und -leiden läßt. Ein Teil der Story ist geschickt als Rückblick erzählt, das fand ich schreibtechnisch interessant, aber dann wurde es total spannend, und ich hab das Buch fix in einem Tag runtergehechelt.
Am nächsten Tag griff ich zum nächsten Francis, zufällig auch der als nächster erschienene (obwohl das bei Francis ja unwichtig ist): In To the Hilt erzählt ein Maler, wie er gegen seinen Willen die Firma seines Stiefvaters retten muß. Der Maler lebt eigentlich in der schottischen Wildnis, fernab von Zivilisation und Familie, und malt (in Acryl) Szenen aus dem Golfspiel. In London und Lambourne trifft er mit seiner Mutter und der übrigen Familie, seiner (Fast-Ex-)Frau, einigen aufrechten Menschen (Steuerprüfer, Banker), einem extrem unkonventionellen Privatermittler und natürlich auch mit Pferden und Fieslingen zusammen. Es geht ein bißchen ums Malen, ums Bierbrauen, aber vor allem ums Geldveruntreuen, und auch dieses Buch hatte ich nach einem Tag durch. (Doch, ich hab jeweils auch noch was anderes getan.)
Deutschsprachige Ausgaben:
Dick Francis: Favorit. 1997. / Verrechnet. 1998. Beide übersetzt von Malte Krutzsch und erschienen bei Diogenes.
 Deborah Crombie: Dreaming of the Bones. 1997.
Deborah Crombie: Dreaming of the Bones. 1997.
Auch auf dieses Buch war ich scharf wegen des literarischen Themas, das mich entfernt an Antonia Byatts Possession erinnerte. Aber natürlich wird das in einem richtigen Krimi anders gemacht, und man braucht (finde ich) auch richtig echt Ermordete. Deborah Crombie ist es ganz gut gelungen, das Literarische in eine Krimihandlung zu verwandeln.
Zum Buch: Eine Biographin kommt nach und nach darauf, daß ihre Dichterin, also die, deren Leben sie schreibend nachvollzieht, wahrscheinlich ermordet wurde. Zufällig ist die Biographin die Ex-Frau eines Polizisten, und sie bittet ihn um Rat. Der Tod der Dichterin liegt nur fünf Jahre zurück, es leben auch noch fast alle aus ihrem Umfeld – und dieses Umfeld ist Cambridge, vor allem die Universität und die Kunstszene. Die Spuren führen zurück in die frühen sechziger Jahre, als die Dichterin und ihre Kommilitonen in Cambridge einen Zirkel aufbauen, der an den (skandalträchtigen) Bloomsbury-Kreis um Virginia Woolf erinnert, und diese Verbindung ist von den jungen Leuten auch ganz bewußt so gewollt. (Die Dichterin verehrt besonders Rupert Brooke, von dem ich bis dahin eigentlich nichts wußte, und ich hatte auch noch keine Gedichte von ihm gelesen …)
Es war schon spannend zu lesen, wie sich erst die Biographin und dann ihr Ex-Mann als Polizist an den Spuren entlang hangeln und wie die alten Geschichten, die begraben werden sollten, wieder aufleben. Allerdings hätte ich mir einen anderen Mörder gewünscht und eine andere Gestaltung des Showdowns; ich finde, beides wird der Qualität der ersten vier Fünftel des Buches nicht gerecht. Und ich habe mich auch manchmal ein bißchen in all den Familiengeschichten “verlaufen”, denn zusätzlich zur Dichterin und ihrer Biographin nebst den dazugehörigen Kreisen lernen wir auch noch die Familien des Polizisten und seiner heutigen Gefährtin (und Kollegin) kennen, und da wimmelt es von Ex-Männern, Müttern, Kindern und Figuren, die nur mal kurz auftauchen und deren Funktion irgendwie nicht erklärt wird. Dennoch lohnt sich das Buch. (Es ist der fünfte Band der inzwischen 14bändigen Serie um das Ermittlerpaar Kincaid und James von Scotland Yard.)
Deutschsprachige Ausgabe:
Deborah Crombie: Das verlorene Gedicht. Übersetzt von Christine Frauendorf-Mössel. Goldmann, 1998.
Aktuell:
Inzwischen ist der Stapel der halb- und angelesenen Bücher wieder furchteinflößend hoch geworden, und manche liegen nun schon so lange darin, daß ich sie noch einmal von vorn beginnen müßte … Und bei manchen muß ich auch wieder auf die passende Stimmung warten. Wenn es nämlich draußen warm wird, habe ich viel mehr Lust auf leichte Lektüre! Und als Vorbereitung auf die noch anstehenden Reisen einen Reiseführer der ganz besonderne Art.
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Bill Bryson, Deborah Crombie, Dick Francis, Jen Banbury, Krimi, Kulturgeschichte, Mary Francis, Mary Stewart, Merilyn Simonds, Patricia Wentworth, Reisebeschreibung, Wayne Grady | Kommentare deaktiviert
Mai 2012
Ihr lieben Lese-Abenteurer,
diesmal entführe ich Euch in unterschiedlich phantastische Welten – keine Reisebücher im eigentlichen Sinne, aber ist nicht jedes Buch eine Reise und jede Buchwelt phantastisch (und im Grunde fiktiv und dennoch wahr)?
 Gladys Mitchell: Death and the Maiden. 1947.
Gladys Mitchell: Death and the Maiden. 1947.
Damit habe ich mich schwergetan. Vielleicht ist es doch zu anspruchsvoll für Bettlektüre – zu komplizierter Plot, schwierige Hauptfigur (wobei ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen kann, daß die Serienfigur auch wirklich die Hauptfigur ist …), reichlich Leute, die man die ganze Zeit schütteln könnte, weil sie sich von morgens bis abends sozialunverträglich aufführen. Oder einfach nicht mein Buch. Dabei mag ich ja diese englischen “Häkelkrimis” aus dem Goldenen Zeitalter!
Zum Buch: Dieser spielt zwar schon nach dem Zweiten Weltkrieg, ist aber trotzdem ein ganz klassischer. Die Bezeichnung “Häkelkrimi” (stammt von Jochen Schmidt) finde ich auch (im Gegensatz zu Schmidt) nicht abwertend, sondern vielmehr treffsicher beschreibend: Es wird nach Muster gehäkelt, sowohl Plot als auch Setting und Figuren, aber wie ein Häkelmuster bietet genau diese Struktur Raum für quasi alles. Und selbst wenn solche Krimis in einer Zwischenreich spielen – nicht ganz Realität, nicht ganz Phantasie -, so erzählen sie uns doch viel über ihre Zeit und ihre Welt. Und sei es nur das Herumgemache mit den Coupons, die in England nach dem Krieg länger in Gebrauch waren als hier in Deutschland. Vor lauter Konstruktion verliert man beim Lesen gern die Handlung aus den Augen, und konsequenterweise hab ich jetzt auch schon wieder vergessen, wer eigentlich der Bösewicht war. ![]()
Aber ich find die trotzdem klasse, und weil Gladys Mitchell mit ihrer schrägen Seriendetektivin Mrs. Bradley – einer freudianischen Psychiaterin, die teils von der Regierung angeheuert wird – in deutschsprachigen Landen gar nicht (weil nur drei Bücher übersetzt) und mittlerweile auch anderen kaum noch bekannt ist, werde ich bestimmt noch weitere Romane der 66bändigen Reihe lesen. (Ich sehe gerade: vor nicht allzu langer Zeit gab es daraus sogar eine TV-Serie mit Diana Rigg in der Hauptrolle. Sehr abgefahren, diese Wahl. Oder vielleicht auch nicht.)
C. J. Cherryh: Conspirator. 2009 / Deceiver. 2011 / Betrayer. 2011.
Das sind die Bänd 10-12 ihrer Serie über Bren Cameron, der bei dem Alienvolk der Atevi zunächst als Übersetzer, aber mittlerweile eher so was wie Chef-Diplomat tätig ist. Natürlich ist es nach den ersten neun dicken Bänden viel “mehr von demselben”, aber Cherryh schreibt so spannend, daß ich mir Band  10 und 11 in Windeseile reingerüsselt habe und Band 12 (der jetzt erst als Taschenbuch vorlag) fix bestellt habe, um nicht Tage oder Wochen auf halber Höhe der Handlung hängenzubleiben. Mittlerweile wird auch aus der Sicht des Fürstensohnes erzählt, für den Cameron eine Art Pate ist, und das ist interessant, weil es Cherryh hier gelingt, menschliche und
10 und 11 in Windeseile reingerüsselt habe und Band 12 (der jetzt erst als Taschenbuch vorlag) fix bestellt habe, um nicht Tage oder Wochen auf halber Höhe der Handlung hängenzubleiben. Mittlerweile wird auch aus der Sicht des Fürstensohnes erzählt, für den Cameron eine Art Pate ist, und das ist interessant, weil es Cherryh hier gelingt, menschliche und Alien-Sicht glaubhaft miteinander zu verbinden. Cherryh verwendet in fast allen ihren Büchern eine sehr strenge Dritte-Person-Singular-Perspektive, fast stream of consciousness; so was ist in der SF eher nicht üblich und auch sonst in Genreliteratur selten. (Von dieser Serie sind nur die ersten drei ins Deutsche übersetzt worden.)
Alien-Sicht glaubhaft miteinander zu verbinden. Cherryh verwendet in fast allen ihren Büchern eine sehr strenge Dritte-Person-Singular-Perspektive, fast stream of consciousness; so was ist in der SF eher nicht üblich und auch sonst in Genreliteratur selten. (Von dieser Serie sind nur die ersten drei ins Deutsche übersetzt worden.)
 C. J. Cherryh: The Pride of Chanur. 1982 / Chanur’s Venture. 1985 / The Kif Strike Back. 1986 / Die Heimkehr der Chanur (Chanur’s Homecoming. 1986).
C. J. Cherryh: The Pride of Chanur. 1982 / Chanur’s Venture. 1985 / The Kif Strike Back. 1986 / Die Heimkehr der Chanur (Chanur’s Homecoming. 1986).
Und weil das so spannend war, habe ich auf eine ältere Serie von Cherryh zurückgegriffen, in der mehrere Alienvölker um die Vorherrschaft in ihrem Quadranten rangeln. Eigentlich sind sie so verschieden, daß sie höchstens als Händler miteinander klarkommen (manche zum Beispiel atmen Methan und denken mit neun Gehirnen in Matrices), aber natürlich spielen sie trotzdem Politik. In dieses Spannungsfeld gerät ein einzelner Mensch, und er wendet sich auf der Flucht vor denen, die ihn gefangengenommen haben, an diejenigen, die er glaubt am besten zu verstehen. Das ist ein Alienvolk, das ähnlich wie Löwen aussieht und auch so lebt. Ich fand es auch jetzt wieder interessant zu sehen, wie ein Konzept (Löwen auf der Erde) auf ein gänzlich anderes (raumfahrende Wesen) übertragen werden kann. Und welche Vorurteile wir alle haben! ![]()
Die ersten drei Bände dieser fünfteiligen Serie hatte ich jetzt neu und erstmals auf Englisch; da die Folgebände auf englisch offenbar Lieferprobleme haben, mußte ich den vierten Band, in dem die Haupthandlung ihren Höhepunkt findet, doch wieder auf deutsch lesen. Bescheuert, diese Serie so aufzuteilen; der fünfte Band (den ich jetzt nicht noch mal gelesen habe) ist eher der Beginn eines neuen Abenteuers mit einer anderen Hauptfigur.
Deutschsprachige Ausgaben:
C. J. Cherryh: Das Schiff der Chanur. 1984 / Das Unternehmen der Chanur. 1986. / Die Kif schlagen zurück. 1987. / Die Heimkehr der Chanur. 1988. Alle übersetzt von Thomas Schichtel, erschienen bei Heyne.
Anne Fine: The Summer House Loon. 1978.
Das gelangte über eine Freundin meiner Mutter zu mir, die mir das von der Autorin signierte Buch zusammen mit einem Foto von sich und der Autorin schenkte, was ich total süß fand. Von Anne Fine hatte ich noch nichts vorher gelesen, wußte nur, daß sie Spannungsromane (?) schreibt, aber auch Kinderbücher. Dies ist ein Buch für etwa Zehn- bis Zwölfjährige, schätze ich.
Zum Buch: Ione nimmt sich zu Beginn jeder Ferien einige gute Vorsätze vor und betrachtet in den nächsten Ferien, wie gut sie sie einhalten konnte. In diesen Sommerferien wird sie jedoch davon abgelenkt, weil der Verehrer der Sekretärin ihres Vaters – der Verehrer ist auch Student bei Iones Vater – sie zur Verbündeten macht bei dem Unternehmen, endlich diese Sekretärin zur Frau zu gewinnen. Genauer gesagt, beschließt Ione, aus lauter Bewunderung für den Verehrer-Studenten, den sie gerade erst kennengelernt hat, ihm zu helfen …
Das ist so erfrischend und witzig geschrieben und so voller ungewöhnlicher Vorfälle und Figuren, daß ich richtig böse war, als ich es aus hatte – nach empörend kurzen 119 Seiten mit jeweils wenig Text drauf … (Keine deutschsprachige Ausgabe. Schade!)
 Kurt Schulze (H): Modern Detective Stories. Cornelsen-Velhagen & Clasing, 1962.
Kurt Schulze (H): Modern Detective Stories. Cornelsen-Velhagen & Clasing, 1962.
Zum Buch: Dieses Heftchen ist ein Relikt aus meiner Schulzeit. Ich kann mich nur noch dunkel erinnern, daß wir zwei der fünf enthaltenen Geschichten gelesen haben. Von den ungelesenen ist mir ein Titel immer in Erinnerung präsent geblieben: “The Strange Case of Steinkelwintz”, von einem mir völlig unbekannten Autor namens MacKinlay Kantor. (Kein Wunder; der hat auch kaum was geschrieben und eher keine Krimis.) Die anderen Stories sind von Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, Freeman W. Crofts und Cyril Hare und durchaus typisch für das jeweilige Werk. Mein Liebling ist natürlich weiterhin “The Milk Bottles” von Sayers, ich könnt mich immer wieder abrollen darüber, wie sie die Arbeit einer Zeitungsredaktion karikiert.
“Modern” finde ich in diesem Zusammenhang eine recht kühne Beschreibung; selbst 1962, als das Heft erstmals erschien, waren die Stories schon nicht mehr modern: Sie stammen aus den 1930-40ern, die von Kantor (dem einzigen Ami) sogar schon von 1929. Wir sollten damals anhand dieser Krimigeschichten Englisch lernen. Das ist zwar nicht ganz falsch gedacht, aber mich hat schon in der Schule gewundert (das muß so in den späten 1970ern gewesen sein), warum dann keine wirklich modernen Texte genommen wurden, in denen auch das aktuelle Vokabular und die Themen der Gegenwart angepsrochen wurden. Copyrightprobleme können es bei diesem Heft nicht gewesen sein; welche Autorin ist nicht begeistert, wenn ihre Texte in Schulbücher aufgenommen werden? (Geld gibt’s ja auch dafür.) Dann war es wohl eher der persönliche Geschmack des Zusammenstellers; aber im Verlag hätte doch vielleicht mal jemand was sagen können … Der Hammer kommt aber noch: Bei meiner Recherche zu diesem Titel im Internet fand ich Hinweise, daß genau dieses Heft offenbar IMMER NOCH in der Schule eingesetzt wird!!! “Modern”, fürwahr. Meiner Treu.
Aktuell:
Immer noch Reisebände (auch das Exit Cafe!) und dies und das …
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Anne Fine, C. J. Cherryh, Gladys Mitchell, Jugendbuch, Krimi, Kriminalstories, Science Fiction | Kommentare deaktiviert
April 2012
Liebe Leserinnen und Leser!
In den vergangenen Wochen kam ich einerseits nicht recht zum Lesen, andererseits hatte ich ein paar ziemlich dicke Brocken angefangen und bin da immer noch dran.
Mary Hoffman: Stravaganza – City of Masks. 2002.
Das ist der erste Band einer Jugendbuch-Reihe, die mir von einer Freundin empfohlen wurde.
Zum Buch: Wir befinden uns in einer Art Parallelwelt: Die Stadt Bellezza ähnelt Venedig im 16. Jahrhundert, doch sie wird von einer Frau regiert, die sich bislang noch gegen die feindliche Übernahme durch einen mächtigen Clan wehren kann, der inzwischen fast das gesamte übrige Oberitalien beherrscht. Alchimie ist einer der Hauptwissenschaften, eine Art funktionierende Magie. Der innigste Wunsch der fünfzehnjährigen Arianna von den Inseln ist es, Gondoliere zu werden, und so schleicht sie sich in die Stadt. Dabei trifft sie auf den gleichaltrigen Lucien – doch der kommt aus dem heutigen London, auf magische Weise durch Zeit und Raum transportiert. Menschen, die so etwas können, werden Stravaganten genannt, Wanderer zwischen den Welten.
Das Konzept ist interessant und wird von der Autorin in den Folgebänden mit anderen italienischen Städten und weiteren Protagonisten aus beiden Welten fortgesetzt, wobei die verbindende Klammer offenbar der Kampf einzelner und der Stadt Bellezza gegen den mächtigen Clan ist. Es las sich auch durchaus zügig; was zumindest im ersten Band nicht ganz so gelungen ist, sind die Spannungsbögen, die jeweils zu kurz sind, um die Handlung insgesamt zu tragen. Ich glaube nicht, daß es daran liegt, weil die Reihe sich eher an 12- bis 14jährige wendet; aber vielleicht legt die Autorin später noch zu. Wegen der Atmosphäre und vieler origineller Ideen zu der Parallelwelt und dem Weltenwandern hat es mir jedoch Spaß gemacht, diesen ersten Band zu lesen.
Deutschsprachige Ausgabe:
Mary Hoffman: Stravaganza – Stadt der Masken. Übersetzt von Eva Riekert. Arena, 2003.
 Walter Moers: Die Stadt der träumenden Bücher. Piper, 2004.
Walter Moers: Die Stadt der träumenden Bücher. Piper, 2004.
Das ist noch eins meiner Weihnachtsbücher. Achtung, es handelt sich nicht um den ganz neuen von Moers (der heißt Das Labyrinth der träumenden Bücher – ärgerlich, solche Titelgleichheiten!), sondern um einen älteren Zamonien-Roman. Sozusagen mein erster Moers, wenn man von den Comics absieht! Schön schräg und sehr buchbegeistert, mit kleinen ironischen Seitenhieben auf unseren aktuellen Literaturbetrieb – dem sich der Autor übrigens vollständig entzieht, er gibt keine Lesungen und es läßt sich noch nicht mal ein aktuelles Foto von ihm finden … ich wußte nicht, was mich im Buch erwartet. Nach den ersten Seiten war mir klar: Das ist Fantasy, ganz traditionell erzählt (der Ich-Erzähler wendet sich oft an seine Leser), aber es hatte auch genau die richtige Portion Witz und Ironie und das richtige Tempo, daß ich flott weitergelesen habe. Ach, und wie er die Bücher und das Lesen und das Schreiben und Dichten liebt!
Zum Buch: “Träumende Bücher” sind diejenigen, die im Laden auf Käufer und Leser warten, sei es frisch gedruckt oder antiquarisch. Und die Stadt Buchhaim besteht eigentlich nur aus Antiquariaten (hin und wieder ein Lokal, in dem vorgelesen wird, und natürlich auch Hotels für die Fans), jedenfalls oberirdisch. Darunter erstreckt sich ein riesiges Höhlensystem, in dem es geheime und nicht so geheime Lagerräume für Bücher gibt, in dem sich frühere Herrscher mitsamt ihrer kostbaren Bibliothek haben bestatten lassen, in dem Bücherjäger nach wertvollen Bänden suchen und dabei nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die heimtückischen Fallen und die schrecklichen Monster kämpfen, und mitunter auch gegen die gesuchten Bücher selbst. In diese Stadt und dieses Labyrinth gerät der junge Dichter und Lindwurm Hildegunst von Mythenmetz auf der Suche nach dem Autor eines perfekten Manuskripts, das Hildegunst von seinem Dichterpaten vererbt wurde …
Gut, es gab ein paar Längen und hin und wieder das Gefühl der Wiederholung, aber für mich war insgesamt die Balance zwischen witziger und spannender Handlung und der großen, großen Bücherliebe gelungen, ich hab mich amüsiert und ich werde bestimmt auch weitere Werke aus Zamonien lesen (die Walter Moers natürlich nicht selbst schreibt, sondern nur übersetzt!). (Übrigens stammt der Ausdruck “schwarzer Gürtel in Rechtschreibung” auch von Moers, aus einem Kleines-Arschloch-Cartoon – jedenfalls hab ich das daher. Quelle, wem Quelle gebührt!)
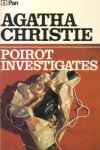 Agatha Christie: Poirot Investigates. 1924.
Agatha Christie: Poirot Investigates. 1924.
Elf frühe Poirot-Geschichten, die – wie ich gerade aus der englischsprachigen Wikipedia lerne, zuerst als Serie 1923 für ein britisches Wochenmagazin geschrieben wurden. Hier wird, insbesondere wenn man sie kurz hintereinander liest, das Gespann Poirot und Hastings etabliert: der geniale Detektiv mit allerlei Macken, der immer recht hat, und sein Freund und Wohngenosse, ein bißchen eitel, aber nicht aufmerksam und nicht mißtrauisch genug, um die Fälle zu lösen. Die Parallelen zu Sherlock Homes und Dr. Watson sind unübersehbar: Die Hilfesuchenden, darunter auch die Polizei und hochrangige Persönlichkeiten, tauchen im Wohnzimmer der beiden Spürnasen auf und tragen ihr Anliegen auch gern schon mal morgens zum Frühstück vor (wobei bei Christie “Frühstück” oder “Tee” eher als Zeitangabe denn als sinnliches Element erscheinen). Oft begeben Poirot und Hastings sich zum Tatort, auch außerhalb der Stadt, und nehmen die Ermittlungen auf. Allerdings werden die geneigten Leserinnen und Leser nicht immer in alle Beobachtungen oder Assoziationen von Poirot eingeweiht und tappen daher wie Hastings bis zum Schluß im Dunkeln. Es geht um zwei Juwelen- und einen Aktiendiebstahl, mindestens vier Morde, mindestens einen Spion, eine Entführung, eine Veruntreuung und ein verstecktes Testament – nette, nostalgische Lektüre für zwischendurch oder vorm Einschlafen.
Deutsprachige Ausgabe:
Agatha Christie: Poirot rechnet ab. Übersetzt von Ralph von Stedman. Desch, 1959.
Derzeit in Arbeit:
Reisebeschreibungen, Essaybände, alte deutsche Science Fiction, Filmbücher, was über Sprache, Gedichte, Bücher von KrimikollegInnen, dies und das – und ich hab mir Breakfast at the Exit Cafe bestellt, das inzwischen auch eingetroffen ist, und dann werde ich wahrscheinlich alles andere erst mal liegenlassen und das lesen! ![]()
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Agatha Christie, Fantasy, Krimi, Mary Hoffman, Walter Moers | Kommentare deaktiviert