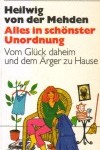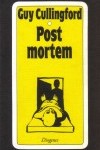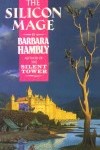Februar 2012
Werte Mit-BuchabenteurerInnen,
diesmal bin ich wieder etwas gemischter! Zu Beginn eines neuen Jahres nimmt man sich ja immer allerhand vor, und dazu gehört sicher oft auch, daß man sich den Überhang aus dem Vorjahr schnell vom Bein schafft. (Bei mir ist das meist auch alles Mögliche aus dem Vorvorjahr und dem Vorvorvorjahr …) Jedenfalls entdeckte ich noch ein vor längerem ausgeliehenes Buch, das ich endlich a) lesen und b) der Eigentümerin zurückgeben wollte (was jedoch erst zwei Monate später gelang):
Frank Schätzing: Der Schwarm. Kiepenheuer und Witsch, 2004.
Zum Buch: Tausend Seiten Handlung voller Action zusammenzufassen ist ein bißchen schwierig, aber da es ja ein Bestseller war, wissen die meisten wahrscheinlich eh, daß es hier um die Rache der Natur (sprich: der Meere) am Menschen geht, und zwar wegen Raubbau, Verschmutzung und genereller Respektlosigkeit. Und genau deswegen wird kein Buch gelesen, denn das hört sich ziemlich öde und nach moralischem Zeigefinger an. Es ist jedoch ein verdammt spannendes Buch, das ich in fünf Tagen heruntergerissen habe. Auch wenn ich anfangs die vielen erzählenden Figuren kaum auseinanderhalten konnte (und einige von ihnen erleben das Ende des Buches nicht, so daß es schwer ist, auf jemandes Seite zu sein, also den eigenen Liebling zu finden), war schnell klar, daß all die mysteriösen Ereignisse am und im Wasser etwas miteinander zu tun haben müssen, und die Jagd nach der Lösung nahm zügig Fahrt auf. Es hat für versierte Krimifans schon etwas CSI-mäßiges, wie in den diversen Labors gefahndet wird, und versierte SF-Fans ahnen schon sehr bald, auf was es hinausläuft – was alles nichts daran ändert, daß ich wissen wollte, WIE sie es schaffen, und natürlich auch, WER es überhaupt noch schafft …
Ich fühlte mich insgesamt sehr an die TV-Serie seaQuest DSV erinnert, mit dem unnachahmlichen Roy Scheider, und einige der Themen des Schwarms waren auch sehr ähnlich. Außerdem frage ich mich, ob Schätzing die Story “The Shining Ones” (1962) von Arthur C. Clarke gelesen hat, was ich zufälligerweise kurz vorher getan hatte – ich würde ihn ja gern selbst fragen! Bei seaQuest kommt auch indirekt Jules Verne vor, der im Schwarm zur Lieblingslektüre einer der Figuren gehört (was mir diese Figur schon fast sympathisch machte) und überhaupt gut zu diesem Buch paßt – in dieser Mischung aus Abenteuer, Wissenschaft, Thriller und Action. Jedenfalls ist dies ein richtiger Schmöker, den man bestimmt gut im Urlaub lesen kann; man sollte das jedoch nicht am Strand tun, denn es könnte das Urlaubsvergnügen etwas schmälern, wenn man sich nicht mehr ins Wasser oder Fisch zu essen traut.
S. S. Van Dine: The Bishop Murder Case. 1929.
So viel Spaß ich mit dem Schwarm hatte, so wenig hatte ich mit dem Mordfall Bischof. Als Nachtlektüre glich das eher einer Folter, weil die Handlung sozusagen in extremer Zeitlupe dahinkrebst. Ich schätze es auch nicht, wenn mir alle paar Seiten versichert wird, daß dies ein besonders gruseliger und schlimmer Fall sei – ich möchte das, wenn überhaupt, auch wirklich spüren. Leider blieb trotz vielfacher Beschwörung jegliches Gruseln bei mir aus. Mag sein, daß wir heute einfach schon zu hartgesotten sind und einen irren Serienkiller, der nach Kinderreimen mordet, schlichtweg viel zu oft schon hatten … Vielleicht lag es auch daran, daß vor allem geschildert wurde, was NICHT passierte, und es passierte ziemlich viel nicht. Am Schluß war es übrigens doch derjenige, der am wenigsten verdächtig war, das hatte man 1929 eben so. Das Ganze sollte – für damalige Verhältnisse – ein besonders anspruchsvoller und literarischer Krimi sein; er gehört zu einer zehnbändigen Serie, die auch umsatzmäßig großen Erfolg hatte, ein begeistertes Fanpublikum anzog und sogar teilweise verfilmt wurde. Nun ja, über Geschmack läßt sich streiten … Die Lebensgeschichte des Autors übrigens fand ich erheblich spannender!
Deutschsprachige Ausgabe:
S. S. Van Dine: Das Zimmer des Schweigens. Übersetzt von D. Fickert. Neufeld & Henius, 1932. / Mordakte Bischof. Neu übersetzt von Marfa Berger. Heyne, 1972. / Der Mordfall Bischof. Neu übersetzt von Sascha Mantscheff. DuMont, 1987.
 Nigel Cassidy / Philippa Lamb: Battenberg Britain. 2009.
Nigel Cassidy / Philippa Lamb: Battenberg Britain. 2009.
Wieso haben wir kein solches Buch aus unseren Breiten? Es würde auch reichen, wenn dieses Buch übersetzt würde – obwohl ich nicht weiß, ob sich der flockige Stil des Autorenduos wirklich gut ins Deutsche bringen läßt, ohne gekünstelt oder platt zu klingen. So was können nur wirklich gute ÜbersetzerInnen, und die übersetzen eher selten Kochbücher oder Bücher, die sich irgendwie mit Essen befassen.
Zum Buch: Denn darum geht es hier: Fertigprodukte, die in den 1960ern besonders Großbritannien überschwemmten und somit die kulinarische Lebensgeschichte vieler Menschen prägten. Cassidy und Lamb haben sich gefragt, ob es diese Produkte noch gibt und wie sie heute wirken (Peinlichkeitsfaktor im Einkaufswagen!). Die meisten stehen erstaunlicherweise noch immer in den Supermarktregalen (auch in unseren – Nescafé, Heinz-Ketchup und Salzstangen, zum Beispiel), manche allerdings den heutigen Gegebenheiten angepaßt, was Rohstoffe, Herstellung und Zutaten angeht. Tollkühn haben die beiden Autoren zahlreiche Selbsttests unternommen und auch ihre Freunde nicht geschont …
Es ist mitunter eine Monty-Python-Show, manchmal auch voller Sehnsucht nach einer „guten alten Zeit“ und durchaus poetisch in den Sprachspielereien. Ich hab viel gelacht und viel gelernt (zum Beispiel, daß es in Japan und auf Hawaii bei MacDonald’s Spam-Burger gibt), und ich weiß eins: Wenn ich das nächste Mal in England bin, MUSS ich unbedingt „French Fancies“ probieren! (Battenberg Cake habe ich bereits selbst mal gebacken.) Und natürlich würde ich das Angebot, ein solches Buch für deutschsprachige Gefilde zu erstellen, sofort akzeptieren!
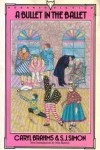 Caryl Brahms / S. J. Simon: A Bullet in the Ballet. 1937.
Caryl Brahms / S. J. Simon: A Bullet in the Ballet. 1937.
Beim Lesen merkt man, wieviel Spaß die beiden gehabt haben, als sie das Buch (das erste einer Reihe gemeinsamer Werke) geschrieben haben – vermutlich haben sie in einer Tour vor sich hingekichert … Es hat Ähnlichkeit mit einem Marx-Brothers-Film. Mit Ballett muß man sich nicht unbedingt (gut) auskennen, denn Caryl Brahms war im wirklichen Leben eine angesehene Ballettkritikerin und kann auch im Roman anschaulich rüberbringen, was es damit auf sich hat und was das Besondere daran ist. Aber überwiegend spielt dieser Krimi hinter den Kulissen, und da findet sich eine ähnlich verschrobene Welt wie beim Theater, wahrscheinlich nur noch abgedrehter. Brahms und Simon (beides Pseudonyme) setzen dem allerdings noch mal etliche Spitzen auf. Wie es sich für ihre Zeit gehört (und wie es technisch auch am einfachsten zu lösen ist, also schreibtechnisch), handelt es sich strukturell um einen guten alten Häkelkrimi, und weil man mich immer gut reinlegen kann, bin ich auch hier nicht auf den Täter gekommen – wer hätte auch gedacht, daß es sich um den Unverdächtigsten des ganzen Romanensembles handelt? Sehr erheiternd auch die Polizei, die mit weitgehend stoischer Ruhe durch den Fall pflügt. Zwei Dinge werde ich also jetzt nach Lektüre tun: erstens mal Petruschka sehen, und zweitens die übrigen Bände der beiden besorgen (die leider nie ins Deutsche übersetzt wurden)!
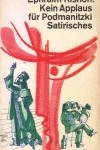 Ephraim Kishon: Kein Applaus für Podmanitzki. Übersetzt (aus dem Englischen!) von Friedrich Torberg. LangenMüller, 1973. [offenbar Texte einzeln original nur in der Zeitung erschienen]
Ephraim Kishon: Kein Applaus für Podmanitzki. Übersetzt (aus dem Englischen!) von Friedrich Torberg. LangenMüller, 1973. [offenbar Texte einzeln original nur in der Zeitung erschienen]
Es ist Zufall, daß ich zwei „Bühnenbücher“ direkt hintereinander habe, denn mit dem Podmanitzki hatte ich aus anderen Gründen und schon lange vor der Bullet angefangen. Dieser Band versammelt alle Satiren von Kishon zum Thema Theater, und auch wenn ich es eigentlich selbst nicht so mit Theater habe – der mittelmäßige Schauspieler Jarden Podmanitzki ist mir ans Herz gewachsen! Als ich Teenager war, bildete Kishon zusammen mit Heinz Erhard und Loriot eine Art Dreigestirn der deutschen Comedy (wie wir heute sagen würden), und ich habe irgendwie unglaublich lange gebraucht, um zu begreifen, daß Kishon mit Deutschland so gar nichts zu tun hat. Sein begnadeter Übersetzer war natürlich Friedrich Torberg (der mit der Tante Jolesch, passagenweise zitierfähig!). Jedenfalls war Kishon Pflicht, der Blaumilchkanal plätschert immer noch durch meine Kindheitslandschaft (und hat bis heute in unserer Gesellschaft nichts an Aktualität verloren!), und Podmanitzki hat mir das Theater vor und hinter den Kulissen nahegebracht, was mir bei meiner ersten Romanübersetzung (Carlson: Vorspiel zum Mord) geholfen hat, und ich bin sicher, daß Kishons Beobachtungen auch auf das Theater von heute immer noch sehr zutreffen …
Harry Kemelman: Friday the Rabbi Slept Late. 1964.
Ich bin vermutlich die einzige meiner Generation (und der davor), die noch nie einen Krimi mit dem Rabbi Small gelesen hatte. Eher zufällig habe ich das nachgeholt und muß sagen: Es lohnt sich absolut! Natürlich ist er mittlerweile fast ein bißchen historisch, aber ich schätze mal nur, was die US-amerikanische und die westliche Gesellschaft schlechtin betrifft … das jüdische Leben wirkt dagegen völlig zeitlos. Kemelmans Erzählstil ist schnörkellos und lebendig, liest sich gut und kein bißchen angestaubt, AUCH nicht, was all die Schilderungen der nicht-ehelichen Beziehungen in der (erfundenen) Kleinstadt in Neuengland angeht, um die es in diesem Krimi geht. Sehr erfrischend, auch weil das Buch nicht so lang ist.
Deutschsprachige Ausgabe:
Harry Kemelman: Am Freitag schlief der Rabbi lang. Übersetzt von Liselotte Julius. Rowohlt, 1966. / Neu übersetzt (?) von Eva Rottenberg. Rowohlt, 2001.
Aktuelle Lektüre:
In Arbeit immer noch den Serienüberblick von “Star Trek – The Next Generation” etc., außerdem Christies frühe Poirot-Geschichten. Alle drei Bücher wandern mit mir durch die Wohnung (und in die S-Bahn), je nachdem, ob ich kurze und unkomplizierte oder spannende oder beruhigend vertraute Lektüre brauche. Das kann zwischen Küche, Klo und Bett schon mal sehr wechseln!
Die übrigen angelesenen Bücher habe ich vorerst wieder weggestellt; es nützt ja nichts, einen “TBR”-Stapel (to be read) zu bilden – diese Biester vermehren sich schneller, als ich sie niederlesen kann.
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Caryl Brahms, Ephraim Kishon, Essen und Trinken, Frank Schätzing, Harry Kemelman, Humor/Satire, Krimi, Nigel Cassidy, Philippa Lamb, Roman, S. J. Simon, S. S. Van Dine | Kommentare deaktiviert
Januar 2012
Frohe Leserinnen und Leser,
es läßt sich hin und wieder nicht vermeiden, ein Buch über einen längeren Zeitraum hinweg zu lesen, entweder weil es dick ist oder weil man wenig Zeit hat, öfter jedoch, weil dieses Buch eine bestimmte Atmosphäre verlangt, eine besondere Tages- oder Nachtzeit oder einen Ort oder die innere Bereitschaft, sich genau jetzt auf Abenteuer, Mord, Liebe oder Schwieriges einzulassen. (Und manchmal, wenn die Pause zu groß geworden ist, muß man von vorn anfangen. Und das Buch kommt einem seltsam unbekannt vor!) Hier also die länger oder kürzer gelesenen Bücher , die in diesem Monat „fertig“ wurden:
Dick Francis: Decider. 1993. / Rat Race. 1970. / Comeback. 1991.
Ich sag jetzt nix mehr dazu, daß ich die anfallsweise lese. Aber ich mach dann auch mal eine Francis-Pause. ![]()
Zu den Büchern: Als Decider tritt ein Architekt auf, der eine Rennbahn 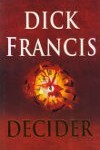 mitsamt der Erbengemeinschaft, der sie nun gehört, vor dem Ruin bewahrt. (Wer jemals Kontakt mit Erbengemeinschaften hatte, weiß nur zu gut, wie ein Krimi daraus werden kann.) Daneben hütet er seine Kinderschar, fünf Jungs, während seine Frau die Zeit woanders verbringt. Mal abgesehen von der spannenden Frage, wer von den Erben die Anschläge begeht, fand ich hochinteressant, wie der Architekt lebt: Er sucht sich halb verfallene Gebäude aus, kauft sie und baut sie eigenhändig um zu Wohnhäusern und Pubs, während er selbst mit Familie darin wohnt. Sind die Gebäude fertig, zieht er weiter. Genau das wünschte ich mir von allen Architekten: daß sie in den Gebäuden, die sie entwerfen, auch tatsächlich wohnen oder arbeiten, und zwar mindestens ein Jahr! Im Laufe der Jahreszeiten würden sie nämlich ganz praktisch herausfinden, ob ihre Entwürfe auch wirklich was taugen. (Ich erinnere mich mit Grausen an eigenartige Beleuchtungs- und Belüftungskonstruktionen in Büros, in denen ich gearbeitet habe, und passive Temperaturregelung in Wohnhäusern ist ein Kapitel für sich!) Vermerken bleibt noch zu Decider, daß der Architekt seine Eheprobleme auf sehr unkonventionelle Weise löst – ich wünschte, mehr Romanfiguren und reale Menschen würden diesen Mut aufbringen.
mitsamt der Erbengemeinschaft, der sie nun gehört, vor dem Ruin bewahrt. (Wer jemals Kontakt mit Erbengemeinschaften hatte, weiß nur zu gut, wie ein Krimi daraus werden kann.) Daneben hütet er seine Kinderschar, fünf Jungs, während seine Frau die Zeit woanders verbringt. Mal abgesehen von der spannenden Frage, wer von den Erben die Anschläge begeht, fand ich hochinteressant, wie der Architekt lebt: Er sucht sich halb verfallene Gebäude aus, kauft sie und baut sie eigenhändig um zu Wohnhäusern und Pubs, während er selbst mit Familie darin wohnt. Sind die Gebäude fertig, zieht er weiter. Genau das wünschte ich mir von allen Architekten: daß sie in den Gebäuden, die sie entwerfen, auch tatsächlich wohnen oder arbeiten, und zwar mindestens ein Jahr! Im Laufe der Jahreszeiten würden sie nämlich ganz praktisch herausfinden, ob ihre Entwürfe auch wirklich was taugen. (Ich erinnere mich mit Grausen an eigenartige Beleuchtungs- und Belüftungskonstruktionen in Büros, in denen ich gearbeitet habe, und passive Temperaturregelung in Wohnhäusern ist ein Kapitel für sich!) Vermerken bleibt noch zu Decider, daß der Architekt seine Eheprobleme auf sehr unkonventionelle Weise löst – ich wünschte, mehr Romanfiguren und reale Menschen würden diesen Mut aufbringen.
In Ra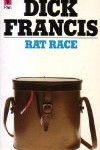 t Race wird weniger gerannt als geflogen, nämlich Lufttaxis zu Rennveranstaltungen, und der Held ist Pilot und hat mit Pferden anfangs nix im Sinn. Dann verliebt er sich in die Schwester eines Starjockeys, die ebenfalls fliegt (und die er auch mal retten muß – in der Luft). Ein früher Francis und in der Handlung geradliniger als die späteren, aber wie alle seine Romane voller ungewöhnlicher Figuren mit überraschenden Aspekten.
t Race wird weniger gerannt als geflogen, nämlich Lufttaxis zu Rennveranstaltungen, und der Held ist Pilot und hat mit Pferden anfangs nix im Sinn. Dann verliebt er sich in die Schwester eines Starjockeys, die ebenfalls fliegt (und die er auch mal retten muß – in der Luft). Ein früher Francis und in der Handlung geradliniger als die späteren, aber wie alle seine Romane voller ungewöhnlicher Figuren mit überraschenden Aspekten.
In Comeback wird ein junger englischer Diplomat zurück  nach England versetzt, aber bevor er seine neue Stelle im Auswärtigen Amt antritt, muß er erst mal eine Veterinärspraxis retten. Ich muß gestehen, daß ich schon nach kurzer Zeit nicht mehr weiß, wie der Plot genau ging, aber das ist bei Francis ja auch ganz unerheblich (er ist sauber gemacht; anderes wär mir sicherlich in Erinnerung geblieben). Ich hab was über das Operieren von Pferden gelernt und viel Pharmazie und Labortechnik, ich mochte natürlich die Hauptfigur, und ich hab einige gemütliche Lesestunden verbracht. Kann ich so nicht von allen Büchern sagen!
nach England versetzt, aber bevor er seine neue Stelle im Auswärtigen Amt antritt, muß er erst mal eine Veterinärspraxis retten. Ich muß gestehen, daß ich schon nach kurzer Zeit nicht mehr weiß, wie der Plot genau ging, aber das ist bei Francis ja auch ganz unerheblich (er ist sauber gemacht; anderes wär mir sicherlich in Erinnerung geblieben). Ich hab was über das Operieren von Pferden gelernt und viel Pharmazie und Labortechnik, ich mochte natürlich die Hauptfigur, und ich hab einige gemütliche Lesestunden verbracht. Kann ich so nicht von allen Büchern sagen!
Deutschsprachige Ausgaben:
Dick Francis: Lunte. Übersetzt von Malte Krutzsch. Diogenes, 1995. // Air-Taxi ins Jenseits. Übersetzt von Heinz F. Kliem. Ullstein, 1970. / Rat Race. Neu übersetzt von Michaela Link. Diogenes, 1998. // Comeback. Übersetzt von Malte Krutzsch. Diogenes, 1993.
Laurence Cossé: Au bon roman. 2009.
Nach den enthusiastischen Lobreden meiner Buchfreundinnen mußte ich dieses Buch natürlich ganz unbedingt haben. Seltsam, daß ich dann nach der Lektüre der ersten Handvoll Seiten eine längere Pause einlegte. Vielleicht war ich ein bißchen enttäuscht von dem Buch, oder genauer gesagt: Ich hatte offenbar etwas anderes erwartet. Ich erwarte ja immer das für mich ultimative Buch, mit allem … Nun habe ich es fast in einem Rutsch ganz gelesen, mit nur einer kurzen Unterbrechung an einem emotional bewegenden Punkt in der Handlung. Und auch wenn ich mir das Ende anders gewünscht hätte (ohne zu wissen, wie ich es mir nun gewünscht hätte!), es ist ein handlungslogisches Ende (und auch die besondere Rolle, die das Datum meines Geburtstags dabei spielt, kann ich nicht krumm nehmen). Im Grunde ist es ein phantastischer Roman (ein bißchen Krimi, ein bißchen Feuilleton), denn so möglich die Handlung sein kann, so wenig wird sie wohl wahrhaftig in der Realität stattfinden.
Zum Buch: Zwei Literaturbegeisterte eröffnen in Paris die Buchhandlung, von der sie schon immer geträumt haben. Darin gibt es nur gute Romane, egal wann und wo die erschienen sind. Die Idee zieht nicht nur überraschend viele andere Begeisterte an, sondern auch Neider, und schon bald gibt es Hetzkampagnen und sogar Anschläge … Und es gibt mehrere sehr melancholische Liebesgeschichten. Und natürlich ganz viele echte Bücher!
Ich glaube, ein solcher Roman kann nur aus Frankreich kommen, jedenfalls habe ich den Eindruck, daß die französischen SchriftstellerInnen viel unbekümmerter und souveräner mit einer gewissen Irrealität umgehen können als etwa deutsch(sprachig)e, und vor allem läßt das Lesepublikum dies offenbar nicht nur zu, sondern findet es auch noch gut, und überhaupt haben sie weniger Angst vor Elitärem. Ob das Buch in unserem Lande der Dichter und Denker (vermutlich sind da die Frauen sowie die deutschsprachigen SchweizerInnen und ÖsterreicherInnen eingeschlossen) Erfolg hat, wage ich zu bezweifeln. Aber er wird sicher einigen Menschen viel Freude machen; vielleicht verwirklicht ja doch irgendwer seinen oder ihren Traum? *hoff*
Deutschsprachige Ausgabe:
Laurence Cossé: Der Zauber der ersten Seite. Übersetzt von Doris Heinemann. Limes, 2010.
Agatha Christie: Hercule Poirot’s Christmas. 1938.
Weil ja Weihnachten drohte, hatte ich ausnahmsweise auch mal Lust auf einen Krimi, in dem so richtig schön englische Weihnacht gefeiert wird, und so griff ich zu diesem. Jedoch – Fehlanzeige!
Zum Buch: Das einzig Weihnachtliche war, daß sich eine Familie mehr als vollzählig versammelte, was ja auch im wirklichen Leben durchaus zu Mord und Totschlag führt. Es ist also ein typischer Agatha-Christie-Landhaus-Häkelkrimi, Untergattung locked room mystery, komplett mit dem unverdächtigen Mörder. Ich fand ihn ein bißchen lieblos runtergeschrubbt, aber das kann daran liegen, daß ich immer noch auf was Weihnachtliches hoffte. Daraus hätte sie meiner Meinung nach schon mehr machen können!
Deutschsprachige Ausgabe:
Agatha Christie: Hercule Poirots Weihnachten. Scherz, 1961. (Wer das Buch übersetzt hat, bleibt ein Geheimnis. Immerhin ist 1993 in der 16 Auflage die Übersetzung mal „überarbeitet“ worden – vermutlich um die vorher gekürzten Teile ergänzt.)
Sujata Massey: The Floating Girl. 2000.
Die Autorin ist zwar US-Amerikanerin indischer Herkunft, ihre Hauptfigur in dieser Serie jedoch eine junge Frau halb japanischer, halb US-amerikanischer Abstammung.
Zum Buch: Rei Shimura lebt jetzt in Japan (so wie es die Autorin einige Jahre lang tat), dessen Kultur ihr häufig unbekannt oder unverständlich ist, sucht und kauft Antiquitäten für ihre Kunden und schreibt für eine Ausländerzeitschrift darüber. Nun will die Zeitschrift auf den Manga-Boom aufspringen, und Rei soll darüber vor dem Hintergrund traditioneller japanischer Kunst schreiben. Dazu muß sie sich aber in das ihr gänzlich unbekannte Thema erst mal einarbeiten, wobei ihr der aktuelle Geliebte gerne hilft. Auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Manga-Zeichner gerät Rei in zwielichtige Etablissements und an die Yakuza. Aber es ist alles viel braver, als es klingt; und abgesehen davon, daß man durchaus eine kurze Einführung in die Manga- und Cosplayer-Szene erhält, fand ich Figuren und Handlung nicht so richtig überzeugend und den Erzählstil zu unbedarft, und genauso ist es mir schon mit dem ersten Band der Serie ergangen. Schade – eine Annäherung an eine so fremde Kultur wie die (moderne) japanische hätte mit einer zwischen den Welten stehenden Figur wie Rei Shimura spannend sein können. (Warum auf dem Cover Kois und Perlen abgebildet sind, weiß ich auch nicht; das sind Themen in anderen Teilen der Serie und kommen in diesem Buch nicht vor.)
Deutsche Ausgabe:
Sujata Massey: Tödliche Manga. Übersetzt von Sonja Hauser. Piper, 2003.
Aktuelle Lektüre:
Enterprise, wie gehabt. Und immer noch das Schlafmittel vorm Einschlafen.
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Agatha Christie, Dick Francis, Krimi, Laurence Cossé, Mary Francis, Roman, Sujata Massey | Kommentare deaktiviert
Dezember 2011
Werte Lesende,
zwischen dem hektischen November und dem hektischen Dezember in der angeblich so besinnlichen und beschaulichen Jahreszeit eine Handvoll Krimis und etwas Lese-Naschwerk:
 Edmund Crispin: The Moving Toyshop. 1946.
Edmund Crispin: The Moving Toyshop. 1946.
Auch wenn das Buch erst nach dem Krieg erschienen ist, gilt es doch immer noch als Häkelkrimi aus den „Goldenen Jahren“ (zwischen den Kriegen), und Edmund Crispin ist das Pseudonym für Robert Bruce Montgomery, der in Oxford studiert hat und später als Komponist (auch für Filme) arbeitete. In seinen neun Krimis und einigen Stories lernen wir den Oxford-Professor Gervase Fen kennen, der ziemlich eingebildet und sehr durchgeknallt ist, weswegen auch die Fälle immer sehr durchgeknallt sind …
Zum Buch: Dies ist wahrscheinlich das bekannteste Buch von Crispin. Es ist schon bemerkenswert, wieviel absurde, witzige und blutrünstige Handlung man in einen einzigen Tag hineinpressen kann, und ich schwöre, daß die Schilderungen von Universitätsmenschen und Orten und allem ziemlich dicht an der Realität sind und sich nicht sonderlich verändert haben in den letzten 65 Jahren! Man kann das Buch auch immer noch mit Stadtplan lesen, sollte aber wissen, daß Gervase Fens (fiktives) St Christopher’s College zwischen St John’s und Balliol liegt.
Deutschsprachige Ausgabe:
Edmund Crispin: Mord im ersten Stock. Übersetzt von Leni Sobez. Heyne, 1974. / Der wandernde Spielzeugladen. Neu übersetzt von Andreas Vollstädt. Haffmans, 1993. / Der wandernde Spielzeugladen. Neu übersetzt von Eva Sobottka. Dumont, 2003.
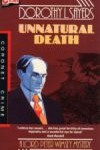 Dorothy L. Sayers: Unnatural Death. 1927.
Dorothy L. Sayers: Unnatural Death. 1927.
Zum Buch: Noch ein – partiell witziger – Häkelkrimi, auch von einer gescheiten Oxford-Absolventin (Sayers ist auch in Oxford geboren), wenn auch vielleicht nicht ganz so abgedreht wie Crispin. Dies ist der dritte Krimi mit Lord Peter Wimsey, der zunächst einmal beweisen muß, daß überhaupt ein Mord stattgefunden hat (weswegen eine deutschsprachige Übersetzung Eines natürlichen Todes und eine andere Keines natürlichen Todes heißt), bevor er sich durch ein unglaubliches Gewirr aus Erbrechtsänderungen, Verwandtschaftsbeziehungen und haufenweise Alibis kämpfen kann. Erstmals tritt hier auch Miss Katherine Climpson auf, eine ältere unverheiratete Frau, die sozusagen die Miss Marple der Sayers ist; sie bleibt jedoch Nebenfigur, Lord Peter hat sie quasi als Helferin eingestellt. Ich schätze ihren unnachahmlichen Briefstil!
Bei aller Liebe zu Sayers ärgert mich jedoch eins an diesem Buch: Die Hauptverdächtige ist lesbisch. Nun können von mir aus gern auch Lesben, Schwule, Behinderte, Kinder, Alte und alle anderen „Randgruppen“, aus denen unsere menschliche Gesellschaft besteht, Bösewichte sein – aber wenn sie so singulär auftreten (es gibt sonst eigentlich keine Lesben bei Sayers) UND dann auch noch unsympathisch sind, nehme ich sie nicht einfach nur als Figur wahr, sondern als Aussage, und das mißfällt mir. Jetzt könnte man argumentieren, daß Sayers in ihrem Werk nur darstellt, wie die zeitgenössische Gesellschaft so was sieht und darauf reagiert (es gab ähnliche Kritik an ihrem Erstling, in dem die Leiche ein Jude war), aber – hm. Es bleibt ein schaler Geschmack zurück. (Ähnlich erging es mir – ebenfalls mit lesbischen Figuren, die verdächtig waren – mit einem Buch von Grafton; dort um so empörender, weil es in den späten 1980ern in Kalifornien spielt, da war man gesamtgesellschaftlich doch schon weiter! Und natürlich will ich, daß meine bevorzugten AutorInnen auch bessere Menschen sind!!)
Deutschsprachige Ausgabe:
Dorothy L. Sayers: … eines natürlichen Todes. Übersetzt von Auguste Flesch von Bringen. Tal, 1936. / Keines natürlichen Todes. Neu übersetzt von Otto Bayer. Wunderlich, 1975.
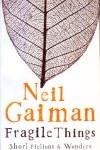 Neil Gaiman: Fragile Things. 2006.
Neil Gaiman: Fragile Things. 2006.
Kein Roman, sondern eine Sammlung von kürzeren Stücken, die vorher an unterschiedlichen Stellen erschienen sind. Ah! Und jedes davon wie eine belgische Praline – gehaltvoll, nur vom Feinsten, ein Universum auf der Zunge! Neil Gaiman hat zunächst „Comics“ geschrieben (den Sandman, alles andere als witzig, aber so gut, so gut!) und Stories und ist dann mit dem Roman American Gods bekanntgeworden. Wo ist er einzuordnen? Könnte ich nicht sagen. Will er wohl auch nicht; es würde ihn zu sehr festlegen.
Zum Buch: Jedenfalls bietet Fragile Things die ganze Bandbreite seines düster-verträumten, mitunter auch humorvollen, fast immer poetischen Schreibens (sind auch Gedichte drin). Gaiman gehört zu den Menschen, die – wie zum Beispiel Jorge Luis Borges – einfach viel zu viel gelesen haben!
Deutschsprachige Ausgabe:
Neil Gaiman: Zerbrechliche Dinge. Übersetzt von Hannes und Sara Riffel. Klett-Cotta, 2010.
 John Myers Myers: Silverlock. 1949.
John Myers Myers: Silverlock. 1949.
John Myers Myers (1906-1988) war ein US-amerikanischer Journalist, Werbetexter und Schriftsteller, der neben historischen und phantastischen Romanen auch historische Sachbücher über den Wilden Westen geschrieben hat. Silverlock hat sich zu einem Kultbuch der Science-fiction/Fantasy-Szene entwickelt.
Zum Buch: Ein Schiffbrüchiger aus Chicago begegnet im Wasser treibend einem Fremden und landet mit ihm auf dessen Heimatkontinent – der bevölkert ist von literarischen Figuren (inkl. zugehöriger Orte und Ereignisse). Das merkt der miesepetrige Chicagoer natürlich erst nicht. Die beiden schlagen sich so durch und geraten an einen Jüngling, dessen Braut einen anderen heiraten will, der natürlich ein Erzbösewicht ist und den Jüngling auch noch um sein Erbe betrogen hat. Das ist alles recht kurzweilig zu lesen, wie der Chicagoer sich mit Circe herumschlägt und mit Erik dem Roten und mit Robin Hood und all den anderen, wie er von der Fairie Queene in ihr Reich gelockt wird etc., und wie er sich währenddessen vom Zyniker zum anteilnehmenden Menschen entwickelt. Hin und wieder wird auch gesungen (der andere Schiffbrüchige ist ein Barde). Das letzte Drittel verbringt er in Dantes Inferno, da wird aber auch kein Höllenkreis ausgelassen, was die Sache extrem zäh macht, so daß ich den Höhepunkt der Handlung offenbar verpennt habe. Dennoch – der Rest lohnt sich durchaus.
Deutschsprachige Ausgabe:
John Myers Myers: Die Insel Literaria. Übersetzt von Annette von Charpentier und Helmut W. Pesch. Lübbe, 1984.
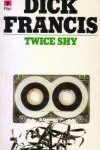 Dick Francis: Twice Shy. 1981. / Break in. 1985. / Hot Money. 1987.
Dick Francis: Twice Shy. 1981. / Break in. 1985. / Hot Money. 1987.
Ähm, ja, ich konnte es nicht lassen …
Zu den Büchern: Twice Shy besticht durch das Experiment, die erste Hälfte von dem Lehrer Jonathan erzählen zu lassen und die zweite, die ein paar Jahre später spielt, von seinem jüngeren Bruder, einem Jockey. Dennoch werden beide gleichermaßen schnell sympathisch. Es geht um ein narrensicheres Wettsystem mithilfe eines Computerprogramms – und das war eigentlich das Interessanteste (und Witzigste), wie Francis uns Computer 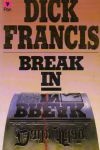 erklärt und Basic beibringt und wie sie mit allerlei Cassetten herumhantieren, auf denen die Programme gespeichert sind …
erklärt und Basic beibringt und wie sie mit allerlei Cassetten herumhantieren, auf denen die Programme gespeichert sind …
In Break in will der Jockey Kit Fielding die Ehe und den Reithof seiner Zwillingsschwester retten, die ausgerechnet jemanden aus einer seit Generationen verfeindeten Familie geheiratet hat. Was Familienbande so aus- und anrichten können!
Das erlebt auch der Jockey Ian in Hot Money – sein Vater heuert ihn als Bodyguard an, obwohl sie seit Jahren nicht miteinander gesprochen haben. 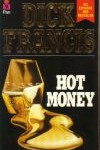 Der Vater ist ein Finanzgenie in Sachen Gold und fühlt sich plötzlich bedroht; seiner Ansicht nach hat das familiäre Gründe, und da ist die Zahl der Verdächtigen, denn er hat fünf Ex-Frauen und etliche Kinder. Ich fand es hier besonders spannend mitzuverfolgen, daß ich die große Zahl der Figuren immer gut auseinanderhalten konnte.
Der Vater ist ein Finanzgenie in Sachen Gold und fühlt sich plötzlich bedroht; seiner Ansicht nach hat das familiäre Gründe, und da ist die Zahl der Verdächtigen, denn er hat fünf Ex-Frauen und etliche Kinder. Ich fand es hier besonders spannend mitzuverfolgen, daß ich die große Zahl der Figuren immer gut auseinanderhalten konnte.
Deutschsprachige Ausgaben:
Dick Francis: Fehlstart. Übersetzt von Malte Krutzsch. Ullstein, 1983. / Zahm und zerbrochen. Übersetzt von Malte Krutzsch. Ullstein, 1987. (Auch: Ausgestochen. Diogenes, 1995.) / Totes Rennen. Übersetzt von Malte Krutzsch. Ullstein, 1989. (Auch: Mammon. Diogenes, 2000.)
Miguel Ruiz: The Four Agreements. 2003.
Das hat mir eine Freundin geschenkt, die es ihrerseits von einer anderen Freundin empfohlen bekam, und ich habe es wiederum an eine Freundin weitergegeben.
Zum Buch: Es handelt sich um die Zusammenfassung der Thesen dieses Miguel Ruiz (angeblich alte toltekische Weisheiten, aber auf so was kommt’s meist gar nicht an), und mehr als eine Zusammenfassung braucht man auch nicht (man kann auch den Wikipedia-Eintrag zu Ruiz lesen). Eine kleine Erinnerung daran, wie man aufrecht durchs Leben gehen kann, und als kleines Geschenk durchaus schön.
Aktuelle Lektüre:
Immer noch den Enterprise-Serienführer. Als Lesestoff für längere Sitzungen was von Kishon vorgekramt, und als Nachtlektüre eine echte Einschlafhilfe …
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Dick Francis, Dorothy L. Sayers, Edmund Crispin, Fantasy, John Myers Myers, Krimi, Lebenshilfe, Mary Francis, Miguel Ruiz, Neil Gaiman | Kommentare deaktiviert