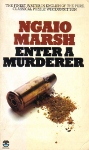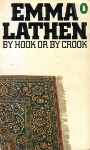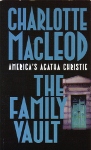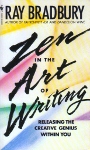Oktober 2012
Geschätzte Buch-Freundinnen und -Freunde,
hier die Leseausbeute des Monats.
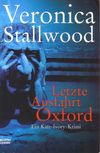 Veronica Stallwood: Oxford Exit. 1994.
Veronica Stallwood: Oxford Exit. 1994.
Zum Buch: Ein Krimi, der natürlich in Oxford spielt und zur Abwechslung mal in der Jetztzeit. Die Liebesromanautorin Kate Ivory nimmt aus Geldmangel zusätzlich den Auftrag an, in den Oxforder Bibliotheken nachzuforschen, wer da und wie genau Bücher klaut. Sie wird eingeschleust als Bibliothekarin und soll offiziell ermitteln, wie lange es für jede Bibliothek dauert, die Angaben aus den Karteikästen in den Computer einzugeben. Während ihrer Tour durch die Institutionen entdeckt sie schnell, wie man die Bücher nicht nur klaut, sondern auch die Computereinträge löscht – und sie stößt auf den Mord an einer Hilfsbibliothekarin, der sie erheblich mehr interessiert.
An sich könnte das eine tolle Geschichte sein, die alles enthält, was mich so fasziniert: eine Autorin, das Schreiben, Oxford, Bibliotheken und Bücher, ein Mord … nur leider vertraut Stallwood offenbar nicht dieser Story, sondern flicht die Geschichte eines Mörders ein, von ihm selbst (scheinbar im Rahmen einer Schreibgruppe) erzählt, und das viel zu ausführlich. Das führt dazu, daß beide Stränge eher dünn wirken und ich mich beim Lesen lange gefragt habe, was jetzt eigentlich die Hauptstory ist und wozu ich die gesamte Kindheit des Mörders wissen muß. (Ich kann das sowieso nicht leiden, wenn “Mörder spricht” – insbesondere, wenn er das in kursiv tut! – eingeschoben wird; das ist so oft ein billiges Mittel zur Spannungserzeugung und mittlerweile auch reichlich abgegriffen.) Auch der ganze Schreibgruppenkram störte nur, denn es sollte doch eigentlich mehr um die Bibliotheken gehen, allenfalls noch um die geklauten Bücher. Zwar gewinnt der Text unterwegs einigermaßen, auch wenn er am Anfang sprachlich und erzählerisch eher dürftig wirkte; aber ich war durch das ganze Hin und Her und einige Figuren verwirrt, die anscheinend nur pro forma auftauchten oder weil die Hauptfigur (die Liebesromanautorin) anders nicht an Info herangekommen wäre.
Und auch wenn die Übersetzung an sich ganz okay war, es waren drei sachliche Fehler drin, die mich sehr geärgert haben, weil sie mit etwas Recherche oder Aufmerksamkeit nicht hätten sein müssen (mushy peas – “matschige Erbsen”, eigentlich: Erbspüree / establishment – “Establishment”, an der Stelle eigentlich: Institution / mysteries of Nancy Drew – “die Mysterien der Nancy Drew”, eigentlich: die Krimis um Nancy Drew).
Deutschsprachige Ausgabe:
Veronica Stallwood: Letzte Ausfahrt Oxford. Übersetzt von Ulrike Werner-Richter. Bastei, 2005.
Dorothy L. Sayers: Strong Poison. 1930.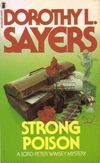
Als Wohlfühllektüre diesmal nicht Francis, sondern Sayers, auch weil ich ja gerade auf der Jahrestagung der Sayers-Gesellschaft (dieses Jahr in Oxford!) gewesen bin.
Zum Buch: Lord Peter Wimsey begegnet erstmals der Krimiautorin Harriet Vane und verliebt sich sofort in sie – dumm nur, daß sie gerade wegen Mordes an ihrem früheren Geliebten vor Gericht steht und die Todesstrafe befürchten muß! Lord Peter hat nicht nur den Ehrgeiz, alle Indizien, die gegen Harriet sprechen, völlig zu entkräften, sondern will auch den wahren Täter ermitteln. Die Zeit drängt. Lord Peter spannt unter anderem seine tüchtige Miss Climpson ein, die eine sehr dünne Spur zu einer geheimnisvollen alten Tante des Opfers verfolgt.
Es ist ungemein witzig, Miss Climpsons Briefe an Lord Peter zu lesen, in denen sie ihre Nachforschungen schildert, die sie einfallsreich und energisch vorantreibt – auch wenn sie dafür an einer Seance teilnehmen muß, bei der sie sogar als Medium auftritt. Sehr erheiternd auch Lord Peters eigene Ausflüge in die Halbwelt von Künstlern und Schriftstellern, bei denen er Harriets Freunde und Feinde kennenlernt, oder wie sein Butler Bunter sich beim Hauspersonal eines Verdächtigen lieb Kind macht … Ich will jetzt für diejenigen, die das Buch noch nicht kennen, gar nicht mehr verraten, außer daß es natürlich gut ausgeht!
Deutschsprachige Ausgabe:
Dorothy L. Sayers: Geheimnisvolles Gift. Übersetzt von Hilda Maria Martens. Nest, 1951. / Neu übersetzt von Otto Bayer unter dem Titel Starkes Gift, Wunderlich, 1979.
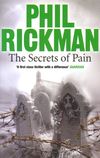 Phil Rickman: The Secrets of Pain. 2011.
Phil Rickman: The Secrets of Pain. 2011.
Dem neuen Band der Serie um die Vikarin und Exorzistin Merrily Watkins habe ich mit Spannung entgegengeblickt, denn mir gefällt diese düstere und geheimnisvolle Atmosphäre des Landstrichs zwischen England und Wales, die als voller Skurrilitäten, Geister, Magie und Geschichte geschildert wird. Merrily ist auch alleinerziehende Mutter einer mittlerweile fast erwachsenen Tochter, die sich für alles Magische und Neopagane brennend interessiert und dazu ein störrischer Teenager ist, und seit einigen Bänden ist Merrily zusammen mit dem Folkmusiker Lol, der immer noch von seinen eigenen Geistern verfolgt wird. Als offizielle Exorzistin der Diözese hat Merrily ohnehin einen schweren Stand – die einen glauben ihr natürlich kein Wort, die anderen sind die bösen Einflüsse, denen sie entgegentreten muß. Rickman schildert das immer so, daß sowohl eine rationale als auch eine magische Erklärung der Vorgänge plausibel erscheint, das finde ich sehr gelungen.
Zum Buch: Diesmal erreicht Merrily der indirekte Hilferuf eines Exorzisten-Kollegen, der sich als Mitglied einer Einheit von britischen Elitesoldaten zu den wahren Vorfällen sehr bedeckt hält – zu bedeckt, denn als er plötzlich und unerklärlich stirbt, fällt es Merrily nicht leicht, seine “Ermittlungen” bei der Armee fortzusetzen. Währenddessen schlägt sich die Polizei mit dem Mord an einem angesehenen Farmer und einem Doppelmord an zwei Bulgarinnen herum, und das Dorf, in dem Merrily lebt, wird von reichen Londoner Geschäftleuten überflutet, die entweder die Häuser aufkaufen und totverniedlichen oder sich an dubiosen Survivalkursen beteiligen.
Ihr seht vielleicht schon das Problem: Es ist zu viel drin in diesem Buch. Das kann es trotz den großen Seitenumfangs diesmal nicht tragen, auch wenn all diese Aspekte (und einige weitere) tatsächlich miteinander verwoben sind. Am meisten jedoch hat mich gestört, daß Merrily zu wenig Raum in der Geschichte gegeben wurde – schließlich ist sie die Figur, die in der Serie alles verbindet. Auch fand ich, daß sie und die anderen Frauenfiguren in den früheren Bänden besser gelungen waren (bzw. richtig gut!). Aber vielleicht muß ich einfach akzeptieren, daß jede Serie auch ihre schwächeren Teile hat. (Noch keine deutschsprachige Übersetzung. Hierzulande ist man erst bei dem vorvorigen Band der Serie.)
Martin Keune: Groschenroman. Be.Bra, 2009.
Dieses Buch hab ich quasi auf einen Sitz verschlungen, weil es nicht nur ungeheuer spannend und schön flüssig plaudernd geschrieben ist, sondern weil auch die Geschichte fesselt. Selbst wenn das für mich an sich nicht ausschlaggebend ist bei der Lektüre, aber diesmal war für mich auch nicht ganz unwichtig, daß es sich um eine wahre Geschichte handelt.
Zum Buch: Der junge Axel Rudolph lernt Bergmann im Ruhrgebiet Ende der 1920er. Doch das Leben ist nicht einfach in dieser Zeit, er verliert seinen Job und beinahe alles andere auch, bis er einen Mann kennenlernt, der ihm von seinen aufregenden Afrikareisen erzählt. Das muntert Axel derart auf, daß er sich traut, an einem Drehbuchwettbewerb der UFA teilzunehmen – denn Geschichten erfinden und erzählen kann er am besten, sie fließen ihm nur so aus der Feder. Tatsächlich kommt er unter die Gewinner, geht nach Berlin und arbeitet für die UFA. Aber weil Axel auch lebenslustig und unbekümmert und temperamentvoll ist, legt er sich versehentlich mit den Nazis an, die inzwischen nach und nach alles vereinnahmen. Er taucht erst mal ab, schreibt Abenteuerschmonzetten und Krimis und alles mögliche unter diversen Pseudonymen und kommt langsam wieder zu Geld. Doch die Nazis sind noch nicht fertig mit ihm.
Boah, hat mich das mitgenommen! Ich kannte zwar den Ausgang noch nicht, als ich das Buch las, aber man mußte ja doch das Schlimmste befürchten … und die Schilderungen, wie Andersdenkende und schließlich so gut wie alle bespitzelt, denunziert, verfolgt und gequält wurden, stand mir deutlich vor Augen. Besonders beklemmend diese Atmosphäre des Mißtrauens und der Angst, daß man sich verbergen mußte, aufpassen, was man zu wem sagte – und der gute Axel sagte eine Menge Unpassendes zu den total falschen Leuten! Wie er dabei immer noch schreiben konnte und einen Haufen Unterhaltungsliteratur sogar veröffentlichen, ist schlichtweg bewundernswert.
Auch wenn es eher als Romanbiographie daherkommt, ist das Buch doch sorgfälig recherchiert, die Quellen sind aufgeführt. Leider fehlten dem Autor immer noch viele Belege, von denen man zwar weiß, daß sie existiert haben, aber nicht, ob sie noch irgendwo vorhanden sind. Für mich – und für alle deutschsprachigen KrimiautorInnen – kann Axel Rudolph als einer unserer “Vorfahren” gelten, und am Schicksal seiner Bücher sehen wir auch beispielhaft einen Teil der Geschichte der deutschsprachigen Kriminalliteratur: Der Krimi lebt in der Demokratie, jeder Diktatur ist er verdächtig – sei es als “wehrkraftzersetzend”, zu unpolitisch oder mit der falschen Politik. Was übrigens dazu führte, daß auch nach dem Zweiten Weltkrieg Rudolphs Bücher oder sein Andenken nicht gerade freundlich behandelt wurden. Na ja, und weil der Krimi ja “nur” Unterhaltung ist, wurde und wird er auch in der Demokratie nicht ernstgenommen – oder höchstens, wenn ihm ein “literarisches” Mäntelchen umgehängt werden kann (was bei Axel Rudolph wohl nicht geht). Es gibt viele Formen von Unterdrückung.
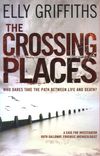 Elly Griffiths: The Crossing Places. 2009.
Elly Griffiths: The Crossing Places. 2009.
Ich kannte die Autorin (eine Britin) noch nicht und nahm daher dieses Buch mal mit, guckte nur mal rein, dachte: “Ach, schon wieder eine Heldin, die mit ihrer Figur nicht zufrieden ist und zwei Katzen hat, schon wieder eingeschobene Textstücke in kursiv – grrrr -, schon wieder im Präsens erzählt” … und fand mich dann in der Mitte des Buches wieder, als ich es widerstrebend aus der Hand legen mußte und die Lektüre erst nach ein paar Tagen fortsetzen konnte (dann aber in einem Stück).
Zum Buch: Ruth Galloway ist forensische Archäologin an der (fiktiven) Universität von Norfolk in England. Ihre Spezialität ist Bronze-/Eisenzeit, daher hatte sie auch vor einigen Jahren an einer Ausgrabung an der Nordseeküste teilgenommen, sich in die Landschaft verliebt und war geblieben. Jetzt wird sie von der Polizei als Expertin für einen Fall konsultiert: Sind die im Watt gefundenen Knochen frühgeschichtlich oder etwa doch diejenigen eines lange verschwundenen kleinen Mädchens? Ruth erkennt das Alter der Knochen auf zweieinhalbtausend Jahre – für sie ein beruflicher Glücksfall, für den ermittelnden Polizisten enttäuschend. Und dann wird noch ein kleines Mädchen entführt …
Natürlich besteht auch dieser Krimi aus den genreüblichen Bausteinen, aber irgendwie waren sie geschickt und erfrischend anders kombiniert. Ruth ist nämlich, trotz ihrer Selbstwahrnehmung, eine aktive und kompetente Frau mit entschiedenen Ansichten, der Polizist ist nicht nur verheiratet mit zwei Kindern und ruppig und Vollmacho, sondern auch akribisch, hartnäckig und wenn es sein muß auch einfühlsam, und auch die jeweiligen Kollegen und Angehörigen der Opfer und sonstige Figuren sind immer “nicht nur, sondern auch”, und das nicht auf plakative oder gewollte Art, sondern überzeugend dargestellt. Das machte die Lektüre für mich spannend, denn ich mußte ja stets damit rechnen, daß die sattsam bekannten Muster eben nicht verfolgt wurden (wurden sie auch nicht). Außerdem hat mich das Thema Archäologie, hier speziell der Bronze-/Eisenzeit ebenfalls interessiert (auch weil in meinem aktuellen Leben erstaunlich viele Kelten vorkommen!).
Deutschsprachige Ausgabe:
Elly Griffiths: Totenpfad. Übersetzt von Tanja Handels. Wunderlich, 2009.
Aktuell:
Ein ganz, ganz, ganz besonderer Lese-Leckerbissen und parallel eine Handvoll klassischer Häkelkrimis von Frauenhand.
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Biographie, Dorothy L. Sayers, Elly Griffiths, Krimi, Martin Keune, Phil Rickman, Veronica Stallwood | Kommentare deaktiviert
September 2012
Liebe LeserInnen!
Im Spätsommer war ich viel unterwegs, und auch wenn ich immer ein Buch (oder vielmehr: viele) dabei hatte, so bin ich vor lauter Erleben nur wenig zum Lesen gekommen.
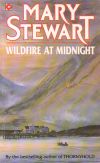 Mary Stewart: Wildfire at Midnight. 1956.
Mary Stewart: Wildfire at Midnight. 1956.
Meine Wohlfühllektüre habe ich fortgesetzt mit dem zweiten Roman von Mary Stewart.
Zum Buch: Das Model Gianetta Brooke will sich vom Londoner Trubel auf der Hebrideninsel Skye erholen. in dem sehr einsam gelegenen Hotel jedoch trifft sie unvermutet auf ihren Ex-Mann, und zusätzlich schwelt über der Gegend die unbehagliche Atmosphäre, die ein unaufgeklärter Ritualmord hinterlassen hat. Verdächtig sind alle Männer, die im Hotel wohnen. Wem kann Gianetta trauen? Dann verschwinden zwei Lehrerinnen auf einer Bergtour.
Obwohl ich dieses Buch zuletzt vor bestimmt dreißig Jahren gelesen habe, konnte ich mich noch an viele Einzelheiten zutreffend erinnern. Fein auch hier wieder, daß die wunderbaren und stimmungsvollen Landschaftsbeschreibungen von Stewart nun im Internet nachempfunden werden können (googelt nach dem Stichwort “Camasunary” – das Hotel im Roman ist erfunden, aber inzwischen gibt an selber Stelle eine Campinghütte). Zusätzlich habe ich ein schönes Interview (25 min) mit ihr gefunden, das noch gar nicht so lange her ist – ich hoffe, die inzwischen 96jährige Mary Stewart genießt ihr Leben in Schottland noch!
Deutschsprachige Ausgabe:
Mary Stewart: Frau im Zauberfeuer. Übersetzt von Hansjürgen Wille und Barbara Klau. Bertelsmann, 1971.
Nancy Livingston: Fatality at Bath & Wells. 1986.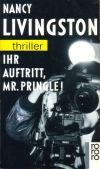
Zum Buch: Mr. Pringle ist ein pensionierter englischer Steuerbeamter, der sein Leben in Gesellschaft der temperamentvollen (und ebenfalls verwitweten) Ex-Barfrau Mavis Bignall angenehm gestaltet. Sie machen ein paar Tage Urlaub in Südwestengland, unter anderem in Bath, wo Pringle wider Willen als Privatermittler in einem Mordfall tätig werden muß. In einem Fernsehstudio wurde der junge Regisseur erstochen, der dem Studioleiter als Nachwuchshoffnung, dem Rest der Truppe jedoch als unbegabter Kotzbrocken galt. Verdächtig sind viele, die inmitten des hektischen TV-Alltags nacheinander von Pringle befragt werden.
Man erfährt sehr viel darüber, wie Mitte der 1980er Fernsehen gemacht wurde, was nicht verwunderlich ist, war die Autorin doch im Hauptberuf Produktionsassistentin. Nebenher schrieb sie acht Pringle-Krimis (der vorliegende ist Band 2) und eine fünfbändige Familiensaga.
Ansonsten habe ich mich über das Buch ziemlich geärgert, was vor allem an der schlechten deutschen Übersetzung lag. Müßte nicht irgendwer (bei Rowohlt immerhin!) zumindest aufhorchen, läse er oder sie Sätze wie diesen: “Ein Stückchen Blätterteiggebäck hatte sich unter Berties Teller geklebt. Er fuhr mit der Zunge unter den Rand, um es zu befreien.” Auch wenn es hin und wieder Slapstickszenen in diesem Roman gibt, ein solches Verhalten würde doch nicht nur in einer Kantine extrem auffallen, oder? Auch die Kurzbio der Autorin stimmt so, wie sie da steht, nicht, was an einem Übersetzungsfehler liegt. Fairerweise muß ich sagen, daß die Romanhandlung wirklich etwas chaotisch ist, weil die Fernsehmacherei im Vordergund steht, und der Roman könnte auch genausogut in jeder anderen Stadt als Bath spielen (die Jane-Austen-Zitate zu jedem Kapitelbeginn ändern nichts daran). Aber so schlecht können die Bücher nicht gewesen sein; immerhin hat der vierte Pringle-Krimi den Last-Laugh-Dagger gewonnen (weswegen er wohl konsequenterweise beim Übersetzen der Serie ausgelassen wurde).
Deutschsprachige Ausgabe:
Nancy Livingston: Ihr Auftritt, Mr. Pringle! Übersetzt von Hubert Deymann. Rowohlt, 1989.
 Jasper Fforde: First Among Sequels. 2007.
Jasper Fforde: First Among Sequels. 2007.
Der Humor von Jasper Fforde ist nicht jedermanns Sache, mir jedoch gefällt er, weswegen ich die hin und wieder auftretenden Längen in seinen Büchern großzügig übersehe. In seiner Reihe um die Buchdetektivin Thursday Next ist dies der fünfte Band.
Zum Buch: In der Handlung ist es ein Sprung von 14 Jahren nach den ersten vier Bänden; Thursday lebt mit ihrer wieder vollständigen Familie immer noch in Swindon (“the Jewel on the M4″). Da die Special Operations, für die sie früher gearbeitet hat, aufgelöst wurden, hat sie mit früheren Kollegen eine Teppichbodenfirma aufgemacht – und alle sind nun heimlich freiberuflich in ihren früheren Jobs tätig. Noch heimlicher jedoch ist Thursday weiterhin in der Buchwelt unterwegs, wo sie sich jetzt unter anderem mit schwierigen Auszubildenden herumschlagen muß. Am schlimmsten findet sie aber, daß ihr Sohn nicht die Karriere einschlagen will, die ihm vorherbestimmt ist – was zum Ende der Welt führen wird.
Soweit die aktuelle Handlung, wenigstens in Grundzügen. Ich mag vor allem all die netten kleinen Situationen, die Fforde für seine Buchwelt, aber auch die “reale” Welt von Thursday Next (die eine Parallelwelt zu unserer ist) erfindet. Das ist oft sehr komisch, gelegentlich verwirrend, manchmal nur allzu real (in unserer realen Buchwelt!) und schon spannend gemacht. Für mich sind es durchaus Krimis, trotz der phantastischen oder Science-Fiction-Aspekte. Sind nicht gerade die an oder auf Grenzen angesiedelten Bücher die besten?
Deutschsprachige Ausgabe:
Jasper Fforde: Irgendwo ganz anders. Übersetzt von Joachim Stern und Sophie Kreutzfeldt. dtv, 2009.
Mary Stewart: This Rough Magic. 1964.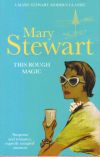
Zum Ausklang noch mal Mary Stewart, von der ich dieses lang gesuchtes Buch nun in England gefunden habe.
Zum Buch: Natürlich ist es wieder eine junge aktive Frau, die in eine undurchsichtige und gefährliche Situation gerät: Die Schauspielerin Lucy besucht ihre hochschwangere Schwester in ihrem Sommerhaus auf Korfu. Beim Schwimmen trifft sie einen Delfin – und wird selbst beinahe von Kugeln getroffen, als ein Unbekannter auf den Delfin schießt. Lucy verdächtigt gleich den unhöflichen Sohn eines geheimnisvollen berühmten Schauspielers; die beiden leben in der Nähe, und der ältere Mann erholt sich angeblich von einem Zusammenbruch. Sympathisch hingegen erscheint ihr ein weiterer Nachbar, ein englischer Fotograf, besonders als der am Boden zerstört ist, weil sein Helfer und Model, ein junger Grieche, ertrinkt. Doch kaum etwas ist auf Prosperos Zauberinsel so, wie es scheint!
Auch hier habe ich im Internet nach dem Schauplatz gefahndet und entdeckt, daß es offenbar eine Menge Leute gibt, die tatsächlich an die Orte ihrer Lieblingsbücher fahren und Fotos davon machen!
Deutsprachige Ausgabe:
Mary Stewart: Delphin über schwarzem Grund. Übersetzt von Hansjürgen Wille und Barbara Klau. Bertelsmann, 1968. (Auch unter dem Titel Die Zauberinsel bei Heyne, 1984.)
Aktuell:
… lese ich immer noch in allen möglichen Büchern, hab viele angefangen auf der Suche nach denen, die zu meinen momentanen Stimmungen passen, hab natürlich auch in allerlei Neuerwerbungen hineingesehen und einige alte Lieben hervorgekramt …
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Jasper Fforde, Krimi, Mary Stewart, Nancy Livingston, Science Fiction | Kommentare deaktiviert
August 2012
Liebe Lesende,
bei Lesewetter (was wahlweise auf sonnenüberflutetem Balkon stattfindet oder in kuscheligem Lesesessel, wenn’s draußen regnet und windet) greift man zu Bewährtem.
Karlheinz Eckardt: Mit Kara ben Nemsi durch den Orient. Karl-May-Verlag, 2004.
Er ist seit hundert Jahren tot, aber lebendig wie eh, zumindest in den Köpfen und Herzen seiner Fans: Karl May. Sein Verlag (der sich ausschließlich mit dem Leben und Werk von May befaßt) hat bereits vor einigen Jahren dieses und das folgende Buch herausgebracht, in denen sich Fans auf die Spuren von Mays bekanntesten Helden gesetzt haben und erforschen, wie deren Heimat heute aussieht und ob noch eine Ahnung vorhanden ist, wie sie damals ausgesehen hat – als die fiktiven Helden durch eine vollständig vom Autor imaginierte Landschaft ritten. Daß Figuren und Settings (egal wie erfunden) immer noch faszinierend sind, ist Mays Verdienst; und Mit Kara ben Nemsi durch den Orient hätte ein ähnliches Verdienst von Eckardt sein können.
Zum Buch: Eckardt ist zu unterschiedlichen Zeiten (als Student, als Erwachsener mit und ohne Frau und Kinder) durch die Länder gereist, die Karl May in seinen Orient-Reisebänden beschreibt und die er zum Teil auch selbst bereist hat, allerdings viel später. Es hätte sich ein tolles Spektrum ergeben können von Tunesien, Libyen, Ägypten, Palästina, Israel, dem Libanon, dem Irak, Syrien und der Türkei, wenn denn all diese verschiedenen Zeitebenen deutlich gemacht worden wären – besonders aufgrund der heutigen Entwicklungen. Die Reisebände (und weitere Abenteuer in Nordafrika und dem Vorderen Orient) spielen ungefähr 1880, May selbst reiste 1899/1900, und Eckardt war in den 1970ern und mehrfach später in der Gegend. Leider sind die modernen Reisedaten nur indirekt zu erschließen. Auch setzt er, wenn er Mays Werke und Briefe zitiert, umfassende Vorkenntnisse voraus, die ja nun nicht jeder hat. Deshalb werden einige Teile und Zusammenhänge für normalsterbliche LeserInnen sehr unklar bleiben … insbesondere, wenn ihre eigene May-Lektüre mehrere Jahrzehnte zurückliegt.
Vielleicht aber war ich nur enttäuscht, weil ich mir unter dem Buch etwas anderes vorgestellt hatte. Ich hatte mehr Zauber des Orients erwartet, Kolonialpomp, Beduinen und Harun al-Raschid, und eine klarere Linie, die Kara ben Nemsis Route enger folgt. So jedoch kann sich das Buch nicht recht entschließen: May-Fanbuch? Sammlung von Reportagen (die fürs Buch besser hätten redigiert werden müssen, damit ärgerliche Wiederholungen entfallen)?
Reiseliteratur ist es allemal, schöne Bilder und historische Fotos gibt’s auch. Nur wird man den Band schwerlich unterwegs genießen, denn durch das Kunstdruckpapier gleicht es eher einem Backstein und ist auch genauso unhandlich.
Thomas Jeier: Auf Winnetous Spuren. Karl-May-Verlag, 2000.
Zum Buch: Äußerlich genauso aufgemacht wie das vorige Buch (und genauso schwer und unhandlich), behandelt dieser Band die Heimat von Winnetou und anderen Figuren, die in den Nordamerika-Erzählungen von May auftauchen. Auch hier war ein Karl-May-Fan am Werk, aber er folgt nur gelegentlich Winnetous Spuren; vielmehr möchte er die heutigen Indianer in den USA breiter vorstellen, mit Schwerpunkten im Südwesten und in den nördlichen Prärien. Auch hier kurze Reportagen, die keine zusammenhängende Erzählung bilden; das wollen sie aber auch gar nicht, sondern befassen sich mit allerlei Aspekten, die in den Amerika-Erzählungen von May auftauchen.
Insgesamt sind die Texte besser geschrieben, und der Autor erzählt weniger von sich und mehr von dem, was er sieht und erlebt. (Nicht daß es schlecht wäre, wenn jemand von sich erzählt – aber wenn es so gar nicht zum Thema paßt?) Vielleicht erscheint der Band auch einheitlicher, weil sich in den USA nun nicht sooooo viel verändert hat – die Landschaft ist noch die Landschaft, und abseits der Hauptstraßen ist noch vieles ähnlich wie vor hundert, hundertdreißig Jahren, und genau abseits moderner Trampelpfade war Jeier vorwiegend unterwegs. May übrigens niemals – anscheinend ist er nur durch ein paar Ostküstenstaaten gereist und hat weder die Prärien noch den Llano Estacado jemals gesehen.
Dick Francis: Dead Cert. 1962 / Nerve. 1964 / For Kicks. 1965.
Mal wieder, diesmal seine ersten drei. (Bzw. die von ihm und seiner Frau Mary geschriebenen …). Generell ist den Francissen nichts Neues hinzuzufügen, außer daß sie gleich von Anfang an so waren, wie sie später immer noch waren. (Hat eine von Euch schon mal eine der Fortsetzungen gelesen, die von Sohn Felix allein geschrieben wurden? Ich habe gehört, daß sie ein bißchen anders sein sollen.)
Dead Cert: Der allererste. Jockey Alan York erlebt beim Hürdenrennen mit, wie sein Freund und Kollege Bill verunglückt. Alan findet heraus, daß der Sturz nicht zufällig war, und als Bill stirbt, ist Alan sehr motiviert, die Urheber dieses Unglücks zu ermitteln. Erst glaubt ihm niemand, dann wird er plötzlich anonym davor gewarnt, weiter nachzuforschen – was er natürlich dann erst recht tut. Es geht um Wettbetrug, irgendwie ist eine Taxifirma in Brighton darin verwickelt, und anscheinend hat auch Alans neue Flamme Kate damit zu tun … Klasse die Verfolgungsjagd, wie Alan zu Pferd von Taxis gehetzt wird.
Nerve: Jockey Rob Finn scheint es endlich in die vorderen Ränge des Hürdenrennens geschafft zu haben, als plötzlich all seine Pferde nur noch als letzte ins Ziel kommen und er zum Gespött der Medien wird. Mißtrauisch geworden, beobachtet er die Rennszene genau und entdeckt andere Jockeykarrieren, die ungeahnt enden, bis hin zu einem öffentlichen Selbstmord (gleich auf der ersten Seite). Und anstatt zu resignieren, entwickelt er einen Schlachtplan, um denjenigen zu finden, der hinter all dem steckt. – Ungewohnt eigentlich, daß so gar keine Polizei ins Spiel kommt; aber die Verleumdungskampagne ist auch so raffiniert, daß es für eine offizielle Verfolgung keine Ansatzpunkte gibt.
For Kicks: Um einem groß angelegten Rennpferddoping auf die Spur zu kommen, heuert der englische Rennsportclub den australischen Pferdezüchter Daniel Roke an, damit der verdeckt ermitteln kann. Das tut er verkleidet als Stallbursche und gerät dabei in immer fragwürdigere Unternehmen. Harte Arbeit ist weniger das Problem, aber Einsamkeit, Mißverständnisse und die Grausamkeiten, die Daniel aufdeckt, nagen an seiner Seele. – Natürlich gibt eine Hauptfigur von Francis niemals auf! Hier sehen wir auch Lehrstück zum Thema “Kleider machen Leute”, was auch heute noch durchaus stimmt. Das Wichtigste für Frauen bei Pferderennen ist ein Hut!
Deutschsprachige Ausgaben:
Dick Francis: Aufs falsche Pferd gesetzt. Übersetzt von Tony Westermayr. Goldmann, 1962. (Auch unter dem Titel Todsicher bei Diogenes, 1993.) / Die letzte Hürde. Übersetzt von Tony Westermayr. Goldmann, 1962. (Auch unter dem Titel Angst bei Ullstein, 1989. Neu übersetzt von Peter Naujack unter dem Titel Rufmord bei Diogenes, 1998.) / Der Trick, den keiner kannte. Übersetzt von Tony Westermayr. Goldmann, 1965. (Neu übersetzt von Malte Krutzsch unter dem Titel Doping bei Diogenes, 2000.)
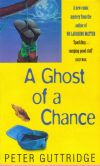 Peter Guttridge: A Ghost of a Chance. 1998.
Peter Guttridge: A Ghost of a Chance. 1998.
Um Abwechslung reinzubringen, aber auch, weil ich demnächst mal nach Bath fahre, habe ich zu diesem Krimi gegriffen in der Annahme, er spiele in Bath. Tut er aber nicht, sondern in Brighton (und ein bißchen auf Kreta). Das machte aber nichts, denn bei der abgefahrenen Handlung und dem witzigen Erzählstil habe ich mich genug amüsiert.
Zum Buch: Ein Reporter wird von seiner Chefredakteurin losgeschickt, um über Gespenster zu berichten, und natürlich findet er eine Leiche. Auf einem Friedhof. ![]() Irgendwie scheint ein esoterisches Zentrum in der Nähe in den Fall verwickelt zu sein, und es geht um Aleister Crowley (also wenn jemand durchgeknallt war, dann der!) und ein geheimnisvolles Zauberbuch …
Irgendwie scheint ein esoterisches Zentrum in der Nähe in den Fall verwickelt zu sein, und es geht um Aleister Crowley (also wenn jemand durchgeknallt war, dann der!) und ein geheimnisvolles Zauberbuch …
Viele Szenen scheinen mehr wegen ihres Slapsticks eingebaut worden zu sein, und manchmal ist es etwas ermüdend, dem zu folgen, aber im Ganzen fand ich es durchaus lustig und, was den Eso-Kram angeht, gut beobachtet. (Und ich wußte bislang auch noch nicht, daß Brighton die esoterische Hauptstadt Europas ist!) Den Autor habe ich übrigens kennengelernt, als ich 2000 mit meiner kollegin Andrea C. Busch beim Bouchercon in Denver war; wir waren für eine Podiumsdiskussion eingeteilt, die von Guttridge geleitet wurde. Ich fand ihn nett, hatte es aber bislang nicht geschafft, was von ihm zu lesen. (Keine deutschsprachige Übersetzung.)
Aktuell:
Nachrichten von der Buchmesse über Neuseeland (zum Beispiel Lektüreempfehlungen) und Otherland von Tad Williams.
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Dick Francis, Karlheinz Eckardt, Krimi, Mary Francis, Peter Guttridge, Reisebeschreibung, Thomas Jeier | Kommentare deaktiviert