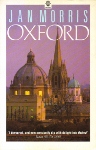März 2013
Werte Buchrunde,
diesmal ist es wieder etwas gemischter bei mir, was Themen und AutorInnen angeht!
 Fanny Morweiser: O Rosa. Diogenes, 1983.
Fanny Morweiser: O Rosa. Diogenes, 1983.
Die Morweiser steht bei mir unter „Krimi“, aber eigentlich steht sie da falsch. Sie schreibt eher so irgendwas zwischen Belletristik und gothic (von der Sorte „Unheimliches zur Mittagsstunde“), Krimielemente kommen, wenn überhaupt, nur ganz am Rande vor.
Zum Buch: In diesem Roman jedenfalls überhaupt nicht. Es geht um ein pubertierendes Mädchen, das Streß mit seiner alleinerziehenden Mutter hat und sich lieber mit ein paar schrägen Freunden beschäftigt und auch deren Nachbarn kennenlernt. Im Grunde aber ist sie nur ein verbindendes Element zwischen mehreren Lebensgeschichten. Das ist alles sehr liebevoll erzählt und auch genau, trotz der Kürze; es gelingt Morweiser wunderbar, mit wenigen Strichen genau das Lebensgefühl Ende der Siebziger zu charakterisieren, und wir lernen auch Heidelberg von einer nichttouristischen Seite kennen.
Auf die Autorin wurde ich wegen des Covers eines ihrer anderen Bücher aufmerksam (dazu aber irgendwann später mehr) und hab auch alles von ihr gelesen; eine ganz besonders große Freude war es für mich, als ich sie 2001 während der Criminale in Mosbach am Neckar sogar bei sich zu Hause besuchen konnte. Sie ist eine ganz zarte und schüchterne und unmittelbar liebenswerte Frau und zeichnet und malt auch.
Lale Andersen: Wie werde ich Haifisch. Schneekluth, 1969.
Ich hatte ja angekündigt, daß ich aus meinen eigenen (belletristischen) Beständen nun alphabetisch Werke deutschsprachiger Autorinnen lesen wollte. Dies ist das erste aus dieser Reihe, die leider wohl nicht sehr lang werden wird, und es ist sicher auch eine Überraschung für Euch. Das kommt daher, daß ich aus Platzgründen einiges unter „Literatur“ stelle, was sonst wohl eher in Kategorien wie „Sachbuch“, „Memoiren“, „Reiseliteratur“, „Biographie“, „Comic“ eingeordnet würde. (Die beste Zufallsnachbarschaft, die in meinem Regal derzeit besteht, ist wohl diese: Erich Loest – Robert Ludlum – Lurchi Salamander!) Gut, also macht nun Lale den Anfang. Sie hieß natürlich nicht wirklich „Lale Andersen“, aber unter diesem Namen ist sie als Sängerin bekanntgeworden – „Lili Marleen“ war das erste Lied, das millionenmal verkauft wurde. Danach wurde sie viel gefragt, wie man Schlagersänger wird, und als Antwort darauf hat sie dieses Büchlein geschrieben.
Zum Buch: Es ist teils Ratgeber (wobei die Ratschläge wohl schon lange nicht mehr nützen), teils autobiographisch, und sie macht das ganz nett, plaudert so vor sich hin. Drumrum finden sich in der Schneekluth-Ausgabe lustige Zeichnungen, die bestimmt heutzutage als frauenfeindlich angesehen werden können, auch wenn die Strichführung noch schön den Schwung der Sixties an sich hat.
Okay, okay, es ist keine literarische Literatur, aber es machte mir durchaus Lust, auch Andersens eigentliche Autobiographie Der Himmel hat viele Farben mal zu lesen.
 Dik Browne: Hägar der Schreckliche – der große Hägar-Superband. Goldmann, 1985. (Ohne Angabe von Originaltitel und Übersetzer)
Dik Browne: Hägar der Schreckliche – der große Hägar-Superband. Goldmann, 1985. (Ohne Angabe von Originaltitel und Übersetzer)
Trotz einem gewissen Zeitgeistigen und trotz der teilweise nicht so gelungenen Übersetzung: Hägar find ich klasse, diesen anarchistischen, gefräßigen und kindlichen Wikinger, und auch seine Frau Helga, Tochter Honi, Sohn Hamlet, den Assistenten Sven Glückspilz und die restlichen mehr oder weniger oft auftauchenden Nebenfiguren. Vieles ist immer noch wie aus dem Leben gegriffen, auch wenn der Autor und Zeichner US-Amerikaner ist. Die kurzen Strips (2-6 Bilder) sind übersichtlich gestaltet, aber dennoch oft voller süßer Kleinigkeiten. Und es ist eine ideale Klolektüre!
 Ruth Klüger: Was Frauen schreiben. Zsolnay, 2010.
Ruth Klüger: Was Frauen schreiben. Zsolnay, 2010.
Ruth Klüger ist Germanistin und hat unter anderem für verschiedene Zeitschriften rezensiert.
Zum Buch: In diesem Band sind 60 ihrer Rezensionen zu Büchern von Frauen (und eine zum Buch eines Mannes) versammelt. Die Rezensionen erschienen ursprünglich zwischen 1994 und 2010 und befaßten sich natürlich mit jeweils aktuellen Werken, und zwar von Schriftstellerinnen aus aller Welt. Das war für mich das eine Tolle, daß ich so einen Einblick erhielt in das literarische Schaffen aus anderen Ländern, als ich bislang meist gelesen habe; das andere Tolle ist auf jeden Fall Klügers Sprache, die ich klar und elegant finde. Mal abgesehen davon, daß ich durchaus viele der von ihr besprochenen Werke auch lesen möchte (wobei ich Harry Potter und den Krimi von Sara Paretsky schon kenne), ich will vor allem mehr von Ruth Klüger lesen, als erstes ihre Essays unter dem Titel Frauen lesen anders. Eine Warnung möchte ich jedoch noch loswerden: Klügers Rezensionen in kleinen Portionen lesen! So hat man/frau auch viiiiiel länger was davon!
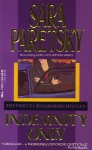 Sara Paretsky: Indemnity Only. 1982.
Sara Paretsky: Indemnity Only. 1982.
Und wo wir grad bei der Paretsky waren, habe ich ihren Erstling hervorgeholt und nach siebzehn Jahren erstmals wieder gelesen (wobei sie allerdings auch schon zu meiner ersten richtigen Krimilektüre in den späten Achtzigern gehörte).
Zum Buch: Ich finde ihn immer noch spannend, denn es ist ein „schlanker“ und actionreicher Roman. Die Privatdetektivin V. I. Warshawski aus Chicago hat darin ihren ersten Auftritt, und es ist offensichtlich, warum das diesen Boom von PI-Krimis aus Frauenhand ausgelöst hat: Zwar erscheint Warshawski schon eher als unverwüstliche Superfrau in jeder Hinsicht, aber genau das machte sie zu einer ganz neuen Identifikationsfigur – sie zeigte, daß auch Frauen einigermaßen glaubwürdig und tough ermitteln konnten und sich zwischen Bankvorständen und Schlägertypen aus der Unterwelt genauso bewegen konnten wie ihre männlichen Vorgänger. Sie waren auch sehr weiblich mit ihrer Freude an heißen Schaumbädern, Sorge um Figur und Fitness bei Essen und Sport und dem lässigen Umgang mit Sex, und dabei hatten sie auch noch ein gesellschaftlich relevantes Umfeld. Warshawski zeigt hier auch schon, wie kritisch sie der Gesellschaft gegenübersteht, in der sie lebt, wobei ihre Welt nicht schwarz und weiß ist – die Gewerkschaftler sind nicht immer die Guten, die Reichen nicht immer die Bösen, und sie nimmt auch die Benachteiligung von Immigranten wahr. Aber vor allem ist sie feministisch; das ist in diesem ersten Buch noch ein wenig holzschnittartig, wenn der Polizeikollege ihres verstorbenen Vaters ihr vorhält, daß Privatdetektivspielen nichts für anständige junge Frauen sei, oder wenn Warshawski im Büro des Bankenbosses sich nicht wie seine Sekretärin herumscheuchen läßt.
Doch, ich finde das Buch auch heute noch gut und freue mich, daß es auch noch lesbar ist – und das sehr gut.
Deutschsprachige Ausgabe:
Sara Paretsky: Schadenersatz. Übersetzt von Uta Münch. Piper, 1986.
 Patricia Moyes: Many Deadly Returns (orig.: Who Saw Her Die? 1970).
Patricia Moyes: Many Deadly Returns (orig.: Who Saw Her Die? 1970).
Zur Nachtlektüre doch wieder ein Häkelkrimi, diesmal einer aus der „neueren“ Zeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, als rundherum schon der psychologische Krimi blühte. Dennoch schien die Begeisterung für traditionelle „cozies“ oder „Landhaus“-Krimis ungebrochen, und dieser ist ein lupenreiner Rätselkrimi.
Zum Buch: Inspektor Henry Tibbett (Moyes’ Serienfigur) von Scotland Yard wird inoffiziell gebeten, nebst Ehefrau dem Geburtstag einer ehemaligen Gesellschaftskönigin beizuwohnen – weil eben diese Lady Crystal befürchtet, ermordet zu werden. Und trotz aller Vorsichtsmaßnahmen stirbt Lady Crystal quasi unter Tibbetts Nase. Der ist sofort davon überzeugt, daß es sich um Mord handelt, schließlich erben die drei Töchter mit ihren Ehemännern je ein ordentliches Vermögen; nur läßt sich in keinster Weise belegen, wie genau der Tod herbeigeführt wurde, und die Todesursache war zweifelsfrei eine Allergie – nur: wogegen?
Ich will nun nicht allzu viel verraten, außer daß die Teile, die mir am konstruiertesten erschienen, tatsächlich diejenigen waren, die auf einem wahren Fall beruhen. Ansonsten fand ich, daß das Buch einige Längen durch vielleicht unnötige Wiederholungen hatte, aber insgesamt war es doch eine nette Lektüre, und von dieser Autorin hatte ich vorher noch nichts gelesen.
Deutschsprachige Ausgabe:
Patricia Moyes: Ein Duft von Mord. Übersetzt von Maria Lampus. Scherz, 1972.
 Damian Thompson: Books Make a Home. 2011.
Damian Thompson: Books Make a Home. 2011.
Das ist natürlich in erster Linie ein Bildband mit Fotos aus durch und durch designten und ungewöhnlichen Wohnungen in England und einigen Metropolen (Amsterdam, Paris, New York), und ganz bestimmt hat niemand, den ich kenne, auch nur annähernd eine ähnliche Bude! Thompson geht aber es darum zu zeigen, daß Bücher nicht nur alphabetisch in Regalen stehen können. Man kann mit ihnen gestalten – sei es eine Ecke, eine Wand oder ein ganzes Zimmer -, indem man ihre Farben oder ihre Formate nutzt, man kann sie „zweckentfremden“ als Unterlagen und Sitzgelegenheiten und Ablagen, man kann auch die Regale ganz unterschiedlich gestalten und einbauen oder anlehnen oder schweben lassen … Das Buch hat durchaus einige Anregungen, mithilfe von Büchern ein wohnliches Zuhause zu schaffen, und es macht schon Spaß, es ab und zu in die Hand zu nehmen und die Vorschläge Revue passieren zu lassen. Interessant fand ich, daß es nach Zimmern (inkl. Flur) aufgeteilt ist und sogar das Bad berücksichtigt. Nur leider kann ich selbst fast nichts davon verwenden; es mangelt mir nicht nur an am ungewöhnlich gestalteten Heim, sondern ich hab auch an die siebentausend Bände unterzubringen. Und ganz ehrlich: Wer stellt sich Bücher in die Küche, die alle gleich groß und in einheitliches graues Papier eingeschlagen sind, damit sie zur Kücheneinrichtung passen? (In der sicherlich eh nie gekocht und gegessen wird, so wie sie aussieht.)
Deutschsprachige Ausgabe:
Damian Thompson: Wohnen mit Büchern. Übersetzt von Brigitte Beier. Gerstenberg, 2012.
 Martha Grimes: Send Bygraves. 1989. / Mit Schirm und blinkender Pistole. Übersetzt von Irmela Brender. Rowohlt, 1993.
Martha Grimes: Send Bygraves. 1989. / Mit Schirm und blinkender Pistole. Übersetzt von Irmela Brender. Rowohlt, 1993.
Grimes hat mal gesagt, daß sie zuerst Gedichte geschrieben hat, und als sie feststellte, daß in ihren Gedichten so viele Krimielemente auftauchten, wechselte sie zum Roman. Dieser Band startet mit ihrem ersten Krimigedicht, und die weiteren sind so gruppiert, daß sie zusammen fast eine Krimihandlung ergeben. Fast – denn sie lassen meiner Ansicht nach mehr als eine Interpretation zu. Grimes amüsiert sich vor allem damit, typische Elemente des Rätselkrimis mit unterschiedlichen Gedichtformen zu kombinieren, und heraus kommt natürlich eine Persiflage. Liest man diesen „lyrischen Krimi“ neben ihrem Erstling, The Man With a Load of Mischief, ergeben sich weitere Parallelen (bis hin zu Figuren und Namen), und es wird deutlich, wie Grimes auch in dem Roman das Subgenre Rätselkrimi parodiert und persifliert. Bygraves ist ein geheimnisvoller Scotland-Yard-Inspector, der nur indirekt auftritt – und ist er vielleicht sogar selbst der Mörder? Die Übersetzerin Irmela Brender hantiert geschickt mit dem Material von Ausgangs- und Zielsprache – aber das hatte ich hatte auch von ihr erwartet, denn ich kannte sie als Verfasserin zweier „biographischer“ Bücher über Miss Marple und Pater Brown (in der leider viel zu kurzen Reihe des Poller-Verlags über berühmte KrimiheldInnen); sie ist Schriftstellerin und Übersetzerin, besonders von Kinder- und Jugendbüchern, aber auch vielen Krimis.
Ich habe die (sehr schön gestaltete und illustrierte) englische und die deutsche Ausgabe parallel gelesen, weswegen ich zwar ein bißchen den Faden der Handlung (sofern eine vorhanden ist) verloren habe, dafür aber um so mehr die Übersetzung würdigen konnte. Leider ist die deutsche Ausgabe nur ein Taschenbuch und ein bißchen nachlässig gemacht (zum Beispiel wurden Strophen vertauscht), aber ich nehme an, sie hat viele der Grimes-Fans, die sie gekauft haben (ist immerhin ins 60. Tausend gegangen, das ist für Lyrik nicht so üblich), auch viel Spaß gemacht. Das Subsubgenre des Krimigedichts existiert im deutschen Sprachraum ja quasi nicht und ist auch eher selten im englischsprachigen; schade eigentlich, ich jedenfalls hätte gern mehr davon.
Aktuell:
Mein Lektüre ist weiterhin recht gemischt: ein Aufsatz darüber, wie groß man als schwarzes Loch wäre, Fantasy um eine Herdhexe, ein heiterer Roman von Mary Scott (der mir doch ein bißchen auf den Keks geht), Kulturhistorisches über Genußmittel und ein US-Gerichtskrimi von 1962 … ich werde berichten.
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Autobiographie, Bildband, Bücher, Comic, Damian Thompson, Dik Browne, Fanny Morweiser, Krimi, Lale Andersen, Lyrik, Martha Grimes, Patricia Moyes, Rezensionen, Roman, Ruth Klüger, Sara Paretsky | Kommentare deaktiviert
Februar 2013
Liebe Leseleute,
im Vormonat hatte ich den Eindruck, daß ich mit dem Lesen kaum vorankomme, weil ich so viele andere Sachen gemacht habe und Stillsitzen irgendwie nicht verlockend erschien. Aber es sind doch mehr als eine Handvoll geworden!
 Maggie Stiefvater: The Raven Boys. 2012.
Maggie Stiefvater: The Raven Boys. 2012.
Dieses Buch hat mir eine Freundin geschenkt, weil sie fand, daß ich es auch lesen sollte. Es hat mir auch ganz gut gefallen – aber ich muß gestehen, daß ich nur sehr schwer hineingefunden habe, und ich habe lange überlegt, woran das wohl gelegen hat. Ich glaube nun, daß es am Erzählstil des ersten Drittels liegt: Dort gibt die Autorin so viel zusätzliche Information zu den jeweils auftretenden Figuren, daß es schwierig wird, der tatsächlichen aktuellen Handlung zu folgen; beispielsweise unterhalten sich da zwei oder drei Figuren, und nach jedem gesagten Satz folgt erst mal eine kurze Rückschau auf ihre Biographie oder ihre Gedanken oder ihr Verhältnis zu anderen Figuren … Weil das eben so schnell von Figur zu Figur springt und zunächst keine wirklich erkennbar ist als Hauptfigur (ich würde mich auch jetzt noch nicht auf eine einzelne festlegen wollen, denn es wird aus Sicht mehrerer erzählt), fand ich das arg verwirrend. Dennoch hat das Buch durchaus einen magischen Charme und wird auch spannend.
Zum Buch: Es geht um ein Mädchen aus einer magisch begabten Familie (wir lernen allerdings nur die weiblichen Mitglieder kennen), die als einzige nicht magisch begabt ist. Über sie gibt es die Prophezeihung, daß sie, wenn sie den Jungen findet, der ihre wahre Liebe ist, und ihn küßt, dieser Junge stirbt. So etwas kann natürlich arg behindern, wenn man grad dabei ist, das andere Geschlecht zu entdecken … Das Mädchen Blue lernt eine Gruppe Jungs vom örtlichen Nobel-Internat kennen, die allesamt ziemlich verschroben sind und sich vorwiegend damit befassen, das Grab eines alten Keltenkönigs auf einer Ley-Linie zu suchen. (Das Buch spielt aber in den USA in einem Ostküstenstaat.) Sie wissen noch nicht, daß nach dem toten König noch jemand anders sucht – und der ist bereit, über Leichen zu gehen.
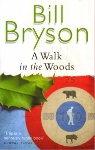 Bill Bryson: A Walk in the Woods. 1997.
Bill Bryson: A Walk in the Woods. 1997.
Ich lese Bryson zwar gerne, aber bei diesem Buch dachte ich bislang immer: Will ich wirklich was über amerikanische Wälder wissen? Dann sah ich zufällig im Herbst vorigen Jahres eine zweiteilige TV-Doku über den Appalachian Trail, einen etwa 3000 Kilometer langen Wanderweg entlang des Appalachengebirges im Osten der USA. Das Erstaunliche daran ist, daß es eine Menge Menschen gibt, die diesen Weg am Stück (dauert etwa 5-6 Monate) wandern oder sich das zumindest vornehmen. Das erfordert zumeist auch das Campen in freier Wildbahn, denn Hotels oder so etwas gibt entlang des Trails kaum. In der Doku wurden ein paar der Wanderer den ganzen Weg entlang begleitet (na ja, alle paar hundert Kilometer interviewt) und die markantesten Punkte der Strecke gezeigt.
Noch erstaunlicher fand ich nun, daß mir dieser Film nicht aus dem Kopf gehen wollte (ich wandere nicht!), und weil ich mich dann auch an das Buch von Bryson übers selbe Thema erinnerte, hab ich es mir zugelegt.
Zum Buch: Bill Bryson entdeckt, daß der Appalachian Trail quasi durch seinen Garten in Maine führt, und beschließt, den ganzen Trail zu wandern. Begleitet wird er von einem Kumpel, mit dem er vor Jahren bereits durch Europa gezogen ist, und diese Beziehung ist nicht so ganz unkompliziert. Die Vorbereitungen für die lange Tour kommen selbst mir Flachländerin ein bißchen chaotisch vor, aber sie schaffen erstaunlicherweise doch ein ordentliches Stück, bevor sie unterbrechen müssen. Bryson wandert ein paar Stückchen allein und trifft sich schließlich mit seinem Freund, um den letzten Abschnitt zu gehen – doch sie brechen ab, weil sie der Anstrengung nicht gewachsen sind. Insgesamt jedoch finden sie, daß es sich gelohnt hat. Dazu und drumrum – typisch Bryson – lesen wir jede Menge Geschichte des Trails, vom Umgang mit den Wäldern in den USA sowie von Fauna und Flora und den Trail-Anrainern, fein sortiert nach den jeweiligen Staaten.
Kurz vor der Lektüre suchte ich im Internet nach der TV-Doku, und wundersamerweise wurde sie Ende Januar noch einmal gezeigt! Das war schon spannend zu sehen bzw. zu erleben, wie sich der deutsche Fernsehfilm und das amerikanische Sachbuch kontrastieren, ergänzen und (ungeplant) kommentieren!
Deutschsprachige Ausgabe:
Billy Bryson: Picknick mit Bären. Übersetzt von Thomas Stegers. Goldmann, 1999.
Jennifer Roberson: Sword-Dancer. 1996.
Um Abwechslung in der Nachtlektüre zu haben, griff ich mal wieder zu Fantasy. Die Autorin war mir erstmals in einer von Marion Zimmer Bradley herausgegebenen Anthologie aus der Serie “Sword and Sorceress” (sozusagen feministische Fantasy) begegnet, und ich erinnerte mich vage, daß sie mir so gefallen hatte, daß ich mir später auch ihre Romanserie besorgte.
Zum Buch: Die schöne Schwertkämpferin Del aus dem Norden ist auf der Suche nach ihrem kleinen Bruder, der in den Süden und in die Sklaverei verschleppt wurde. Del heuert als Führer den Schwertkämpfer Tiger an. Gemeinsam ziehen sie durch die südliche Wüste. Tiger ist zunächst sehr skeptisch, was die Fähigkeiten einer Frau beim Schwertkampf angeht, aber er ist von Del sehr fasziniert. Unterwegs begegnen ihnen wilde Raubtiere, wilde Wüstenstämme mit feindlichen und freundlichen Absichten, Stürme und Sklavenhändler … und schließlich finden sie auch, wonach sie suchen, nur ist alles ganz anders als gedacht.
Hm. Dümpelte so ein bißchen dahin, die Handlung, und ich muß auch sagen, daß der gesellschaftspolitische Anspruch von damals (eigentlich aus den 1980ern) nicht in jedem Buch dem Zahn der Zeit standhält. Ich fand den Ich-Erzähler Tiger echt begriffsstutzig, was die Fähigkeiten seiner Arbeitgeberin anging, und das ging mir nach einer Weile doch auf die Nerven, kurz: die Figur war nicht überzeugend. Und die Handlung war zu konventionell, um all das wettzumachen. Vielleicht haben sich die Folgebände besser gehalten.
Deutschsprachige Ausgabe:
Jennifer Roberson: Schwerttänzer. Übersetzt von Karin König. Heyne, 1993.
 Christian Schärf: Schreiben Tag für Tag. Duden, 2012.
Christian Schärf: Schreiben Tag für Tag. Duden, 2012.
Ein Neuzugang in dem von mir so geliebten Genre “Schreibbuch”! Bzw. gleich eine neue Reihe (als Duden-Taschenbücher), herausgegeben von Hanns-Josef Ortheil, der Professor für Kreatives Schreiben an der Uni Hildesheim ist. Viele aus seinem Team geben auch Kurse an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel; die Kurse dort wurden oft von TeilnehmerInnen gelobt. Ich vermute mal, daß diese Reihe aus den Kursen dort und an der Uni entstanden ist, jedenfalls wendet sie sich an Menschen, die intensiv schreibend arbeiten und dazu auch literaturwissenschaftlichen Hintergrund wollen.
Zum Buch: Das Buch befaßt sich mit dem Thema Tagebuch in allen möglichen formalen Erscheinungen. Es ist in 25 Kapitelchen aufgeteilt. Zuerst wird jeweils eine bestimmte Art Tagebuch beispielhaft an dem Werk eines bekannten Schriftstellers vorgestellt, dann folgen ein, zwei Aufgaben, wie man sich selbst dieser Art des Tagebuchführens annähern kann. Wie nebenbei bekommt man ein bißchen Literaturgeschichte mit, und es gibt eine kommentierte Liste verwendeter und weiterführender Bücher.
Der Stil ist eher dröge und manchmal unimäßig geschraubt (“… das Notizbuch dauernd mit sich führen, um gegebenenfalls eine Eintragung vornehmen zu können” – das hätte man sicher auch eleganter formulieren können), aber das Buch ist schließlich ein ernsthaftes Arbeitsbuch und kein flippiger halbautobiographischer How-to-Write-Ratgeber. Ich war einfach nur neugierig, was es zum Thema Tagebuch aus handwerklicher Sicht alles zu sagen gäbe, und ich fühle mich nach der Lektüre nun sehr bereichert und auch angeregt, sowohl zum Schreiben als auch zum Lesen. Allerdings kann ich nicht glauben, daß es nicht mehr Tagebuchbeispiele von Frauen gegeben hätte! Noch nicht mal ein Viertel machen die Aufzeichnungen von Christiane Goethe, Anais Nin, Franziska von Reventlow, Romy Schneider, Susan Sontag und Virgina Woolf aus.
 Sharyn McCrumb: She Walks These Hills. 1994.
Sharyn McCrumb: She Walks These Hills. 1994.
Noch mal Appalachen! Diesmal als Kriminalroman. Sharyn McCrumb hat eine Reihe geschrieben, die in dieser Gegend spielt und in der sie örtliche Balladen, Legenden und Überlieferungen aufgreift, die Anlaß und Hintergrund für ihre Handlungen bilden. Die Bücher wurden mit allen möglichen Preisen überhäuft. Ich weiß nicht, ob es durchgehend auftretende Figuren gibt; dies ist der erste, den ich aus dieser Reihe gelesen habe. Von McCrumb kannte ich vorher ein, zwei Bücher aus ihren beiden anderen Krimireihen, die mir gefallen haben.
Zum Buch: Aus einem Gefängnis bricht ein 63jähriger Häftling aus, der dort lebenslang wegen Mordes sitzen sollte. Er ist krank, hat jegliche Erinnerung an die letzten Jahrzehnte verloren, wähnt sich teils in seinen Zwanzigern, teils noch früher, aber er will nach Hause zu seiner Frau und seiner kleinen Tochter, und weil er sich von Kindesbeinen an in den Bergen auskennt und mit seinem Onkel viel jagen und schwarzbrennen war, kommt er auch ganz gut voran. Sein Heimatort im hinterwäldlerischsten Tennessee ist jedoch in hellem Aufruhr; der Flüchtige hat schließlich seinen Nachbarn mit einer Axt erschlagen. Die Frau hat sich scheiden lassen und jemanden anders geheiratet, die Tochter ist erwachsen und studiert Geologie. Ein Radiomoderator interessiert sich für die Hintergründe des Falls, doch seine Nachforschungen gestalten sich erstaunlich schwierig. Und bei der örtlichen und unterbesetzten Polizei sieht die bisherige Telefonistin ihre Chance, endlich selbst Deputy Sheriff zu werden.
Ein düsteres und melancholisches Buch, aber gut zu lesen und spannend durch seine Vielschichtigkeit. Und ich hatte ja nun auch aktuell den geographischen Hintergrund – wobei mir gerade einfällt, daß ich selbst fast in der Zeit und fast in der Gegend gewesen bin, nämlich in Charlotte, North Carolina, was nicht so weit weg ist (aber eher unbergig).
Deutschsprachige Ausgabe:
Sharyn McCrumb: Schatten über den Bergen. Übersetzt von Karin Polz. Rowohlt, 1995.
Doris Egan: The Gate of Ivory. 1989.
Auch dies Nachtlektüre, auch dies aus der Ecke “feministische Science Fiction und Fantasy”, auch dies ein erster Band (einer Trilogie) – im Gegensatz zum Buch von der Roberson hat es sich ein bißchen besser gehalten, vielleicht weil es nicht Fantasy, sondern Science Fiction ist.
Zum Buch: Die Studentin Theodora strandet nach einer interstellaren Spritztour mit Freunden auf dem Planeten Ivory, auf dem es Magie und tödliche Duelle zwischen den mächtigen Adelshäusern gibt. Sie schlägt sich mit Kartenlegen durch und hofft, irgendwann genug Geld für ihre Rückfahrkarte zu haben. Deshalb akzepiert sie das großzügige Angebot eines jungen Mannes, bei ihm in Dauerstellung die Karten zu legen – nicht ahnend, daß sie nun in eine interne Fehde hineingezogen wird, die sie kreuz und quer über den Planeten führen wird.
Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, worum es in dem Buch nun geht, mal abgesehen von besagter Fehde. Es wird breit erzählt, daher sind viele Elemente nicht unbedingt wichtig für die Handlung dieses ersten Teils, der allerdings in sich abgeschlossen ist. Möglicherweise erschließt sich auch hier erst mit den nächsten Bänden die eigentliche Qualität der Bücher – ich habe sie vor ziemlich genau sechzehn Jahren gelesen und seitdem nicht wieder.
Deutschsprachige Ausgabe:
Doris Egan: Das Elfenbeintor. Übersetzt von Michael Morgental. Heyne, 1994.
Aktuell:
Ein Buch mit Rezensionen, Gedichte und zwei sehr unterschiedliche Krimis. Auch habe ich endlich angefangen, meine Literatur-Bibliothek zu sortieren und zu inventarisieren (nachdem ich mich schon durch Krimi, Science Fiction + Fantasy, Nachschlagewerke, Kochbücher und Schreibratgeber gekämpft habe!) und mache täglich erstaunliche Entdeckungen darin! Ich wollte ja wieder mehr Werke deutschsprachiger Schriftstellerinnen lesen und habe mich nun entschlossen, aus meinen vorhandenen Beständen von jedem Buchstaben eine zu lesen (so ich da was hab). Das wird, bedingt durch meine hochindividuelle Auswahl, recht überraschende Ergebnisse haben!
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Bill Bryson, Christian Schärf, Doris Egan, Fantasy, Jennifer Roberson, Jugendbuch, Krimi, Maggie Stiefvater, Reisebeschreibung, Schreibbuch, Sharyn McCrumb | Kommentare deaktiviert
Januar 2013
Liebe Lesende,
willkommen im neuen Bücherjahr! Und weil jetzt Winter ist, hier meine zur Jahreszeit passende Lektüre der letzten Wochen.
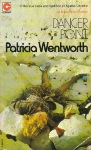 Patricia Wentworth: Danger Point. 1942.
Patricia Wentworth: Danger Point. 1942.
Die Wentworth ist mir, wie Ihr ja schon wißt, eine liebe Nachtlektüre – obwohl sie doch manchmal finsterer ist, als mir lieb wäre, selbst auf ihre altmodische Häkelmanier. Und manchmal rege ich mich auch fürchterlich über sie auf, wenn sie etwa ganze Handlungsteile wieder und wieder erzählt oder wenn ihre Frauenfiguren sich dämlicher anstellen, als ich noch zu glauben bereit bin. Danger Point ist der vierte Band mit ihrer Serienfigur Miss Silver, die ein bißchen Miss Marple ähnelt (die beiden sind auch zeitgleich in Erscheinung getreten), im Gegensatz zu der jedoch ihre Ermittlungsdienste professionell anbietet. Leider ist Miss Silver oft nur eine Randfigur in ihren eigenen Romanen – so auch in diesem.
Zum Buch: Zunächst einmal lesen wir etwa hundert Seiten lang vom Leben der reichen jungen Lisle, die sich fragt, ob ihr Mann sie vielleicht ermorden will – weil er vielleicht auch schon seine erste (reiche) Frau ermordet hat … nur um das Geld in den Erhalt eines scheußlichen alten Kastens von Herrenhaus zu stecken, an dem er mit abgöttischer Liebe hängt. Das alles könnte richtig finster in bester Manier von Barbara Vine oder Minette Walters sein, die Wentworth hat durchaus manchmal ein Händchen dafür. Doch mit der blutleeren und waschlappigen Lisle, aus deren Sicht wir meist die Handlung erleben, funktioniert es nicht. Ich hätte die Tussi gelegentlich schütteln können, wenn sie sich immer wieder versucht einzureden, wie sehr ihr Mann sie doch wirklch liebt! Ob er jedoch wirklich hinter den diversen Anschlägen steckt, die auf Lisle verübt werden, ist sehr lange nicht klar, denn immerhin gibt es weitere Verdächtige, nämlich Cousine und Cousin des Ehemannes, die quasi mit im Haus leben. Und als Miss Slver dann gaaaaaaanz weit hinten endlich in die Action eingreift, geht alles sehr fix – viel zu fix, leider.
Dies ist also einer der schwächeren Silver-Romane, dafür aber – im Gegensatz zu vielen anderen – ins Deutsche übersetzt. Die Methode hinter diesen Übersetzungen ist mir unklar, denn sie sind weder chronologisch noch vollständig; ich kann’s mir nur so erklären, daß während des kurzen Häkelkrimi-Revivals, das wir Anfang des Jahrtausends hatten, noch ein paar alte Lizenzen abgefrühstückt wurden, und als das doch nicht den erhofften Erfolg brachte (wie auch!), schnell wieder eingestellt wurden. So ist das halt manchmal …
Deutschsprachige Ausgabe:
Patricia Wentworth: Das alte Haus am Meer. Übersetzt von Andrea Zapf. Goldmann, 2003.
 Maj Sjöwall / Per Wahlöö: Det slutna rummet. 1972.
Maj Sjöwall / Per Wahlöö: Det slutna rummet. 1972.
Das ist natürlich ein moderner Klassiker der Kriminalliteratur, jedenfalls und ganz besonders im deutschsprachigen Raum. Abgesehen davon, daß die ganze zehnbändige Reihe um Kommissar Martin Beck und sein Team in Stockholm (die neuere TV-Serie ist nur vage angelehnt an diese Bücher) sehr gut und auch heute noch gut zu lesen ist – weswegen eine vollständige Neuübersetzung veröffentlicht wurde -, haben diese Krimis im deutschsprachigen Raum einen starken Einfluß auf unsere eigenen KrimiautorInnen ausgeübt: Die Idee des Krimiteams kommt daher und auch die sehr politische und sozialkritische Sicht auf Polizei, Täter, Opfer und Tat. (Erinnert sich eine von Euch noch an den deutschen Soziokrimi?)
Für mich ist und bleibt dieser Band (Nr. 8 der Serie) der beste.
Zum Buch: Martin Beck ist im vorigen Band angeschossen worden und kommt erst jetzt so langsam wieder zur Arbeit. Für den Anfang geben sie ihm einen “leichten” Fall: ein rätselhafter Mord an einem Mann, der sich anscheinend ohne Waffe selbst erschossen hat, und das in einer hermetisch verschlossenen Wohnung. Das übrige Team ist ohnehin intensiv mit der Aufklärung von Banküberfällen beschäftigt, die immer häufiger und scheinbar von einer einzigen Bande verübt werden. Ja, Beck kann seinen Fall aufklären, aber es kommt alles ganz anders als gedacht. Und ja, auch die Banküberfälle finden eine Art von Lösung – von der ebenfalls alle (einschließlich des mitlesenden Publikums) überrascht sind!
Immer noch schön finde ich diese Mischung aus Einfühlungsvermögen und beißender Sozialkritik, oft verbunden mit völlig absurden und teils hochkomischen Situationen! Ich hab in der S-Bahn gelesen und vor mich hingelacht, und obwohl ich mich gut an die Handlung erinnern konnte (hab’s früher oft gelesen, war einer meiner ersten Krimis Anfang der 1980er), fand ich es schwer, das Buch auch nur vorübergehend aus der Hand zu legen. Und mit dem Wissen von heute über Krimis und die Entwicklung im deutschsprachigen Raum kann ich mir nun auch viel besser vorstellen, welchen Knalleffekt diese Bücher damals gehabt haben, sowohl aufs Publikum als auch auf die AutorInnen!
Deutschsprachige Ausgaben:
Maj Sjöwall / Per Wahlöö: Verschlossen und verriegelt. Übersetzt von Hans-Joachim Maas. Rowohlt, 1975. Neu übersetzt von Paul Berf. Rowohlt, 2008.
Vielleicht ist das Leben dieser Autorin noch interessanter als ihre Bücher, aber ich hab bei der Erstlektüre von all dem noch gar nichts gewußt. Ich wollte ein Buch über Oxford lesen und gewann den Eindruck, dieses sei das beste – ein Porträt der Stadt, kein Reiseführer im eigentlichen Sinne, auch keine geschichtliche Abhandlung, sondern ein buchlanges Essay, eine Plauderei mit Fakten, Anekdoten, Zusammenhängen, Beschreibungen, Erklärungen … eben so intensiv englisch! (Und konsequenterweise auch nicht ins Deutsche übersetzt.)
Oxford ist meine Traumstadt, das wußte ich schon lange, bevor ich vor zehn Jahren erstmals hinkam. Ich las als Teenager Aufruhr in Oxford von Dorothy L. Sayers mit einem Reiseführerheftchen daneben, das ich aus den Beständen meiner reisefreudigen Patentante übernommen hatte. Der Krimi ist von 1936, das Heft von 1956 oder so, Morris’ Buch erschien erstmals 1965 und wurde bis 1991 (und vielleicht danach auch noch) mehrfach aktualisiert – und Oxford hat sich eigentlich kaum verändert. Jedenfalls nicht in den letzten achthundert Jahren. Es ist eine Stadt der Geschichten, die vor allem um das Wissen und Lernen und Lehren kreisen und deren handelnde Figuren – seien sie real oder fiktiv – reich an Merk-Würdigkeiten sind. Und Morris schreibt sehr innig über die Stadt, in der er studiert hat und die sie als gestandene Journalistin und Reisebuchautorin noch besser kennenlernt – innig und verständnisvoll und lyrisch und mit feinem Humor, hach, es ist einfach toll! Nur darf man nicht zu viel auf einmal lesen.
 Mary Scott: Breakfast at Six. 1953.
Mary Scott: Breakfast at Six. 1953.
Auch Mary Scott ist eine neuseeländische Autorin gewesen, aber offenbar ist sie mittlerweile selbst dort wieder vergessen, obwohl sie ziemlich produktiv und sehr erfolgreich war. Vielleicht liegt es aber auch daran, daß sie überwiegend heitere Romane und ein paar Krimis (gemeinsam mit einer Kinderbuchautorin!) geschrieben hat, so was wird ja häufig nicht als ernsthaftes literarisches Werk gesehen. Für mich war sie die erste Berührung mit Neuseeland – ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, wann ich dieses Buch erstmals gelesen habe, vielleicht mit zehn oder so.
Zum Buch: Es ist der Auftakt zu einer halb autobiographischen Serie über drei Schaffarmerfamilien in der Wildnis der Südinsel. Scott hat auch ein Buch mit “echten” Memoiren dazu veröffentlicht, das realistischer und kritischer (und auch einzigartig in der neuseeländischen Literatur) sein soll, das habe ich aber noch nicht gelesen. Die heiteren Romane um Susan und Larry und ihre Männer und Freunde in der kleinen Gemeinde im neuseeländischen Busch kenne ich jedoch fast alle, und ich habe jetzt beim Wiederlesen festgestellt, daß sie zwar wirklich etwas naiv und schönfärberisch (und inzwischen angestaubt) sind, ich aber zumindest den ersten immer noch weitgehend lustig und vor allem lesbar finde. Ich hätte den Roman gern auf Englisch gelesen, aber offenbar ist es schier unmöglich, eine solche Ausgabe zu bekommen! Die Übersetzung ist schon hin und wieder etwas seltsam und unbeholfen.
Deutschsprachige Ausgabe:
Mary Scott: Frühstück um sechs. Übersetzt von Arno Dohm. Goldmann, 1956.
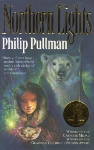 Philip Pullman: Northern Lights. 1995.
Philip Pullman: Northern Lights. 1995.
Auf dieses Buch (das erste einer Trilogie) wurde ich durch eine Anzeige aufmerksam, in der es (bzw. die deutsche Erstausgabe) als DAS neue Fantasy-Ereignis vorgestellt wurde. Den Autor kannte ich nicht; kein Wunder, denn er hat im wesentlichen für Kinder und Jugendliche geschrieben, was er eigentlich auch mit dieser Trilogie tut. Ich halte sie jedoch auch für Erwachsene geeignet; manche würden vielleicht sogar finden, daß sie für Kinder ab zwölf nicht so paßt (ICH hätte es in diesem Alter sehr gern gelesen!), weil ziemlich finster. Ich fand es jedoch voller origineller Einfälle und interessanter Figuren und insgesamt viel zu kurz.
Zum Buch: Heute würden wir diese Bücher wohl als “Steampunk” bezeichnen, denn sie spielen – zumindest im ersten Band – in einer quasiviktorianischen Parallelwelt, die allerdings nur ein bißchen anders ist als unsere. Folglich gibt es darin auch Oxford, und von einem Oxforder College aus startet die Handlung. (Warum wohl hab ich das Buch gelesen …?) Die zwölfjährige Lyra wächst in der Obhut des Colleges auf. Ihr Onkel ist ein berühmter Nordlandforscher, der in den Nordlichtern den Zugang zu anderen Parallelwelten entdeckt hat (was die Kirche gar nicht freut!). Auch Lyra zieht es dorthin – doch sie bricht erst auf, als ihr Freund von einer finsteren Bande entführt wird und sie ihn retten will. Unter abenteuerlichen und gefährlichen Umständen kommt sie auf der Fährte der Entführer in den hohen Norden … Der deutsche Titel bezieht sich auf ein seltsames Gerät, das Alethiometer, das Lyra anvertraut wird und mit dem sie nach und nach lernt umzugehen. Es ist eine Art Weissagungsgerät, das jede Frage wahrheitsgemäß beantwortet, und Lyra hat ein natürliches und einzigartiges Talent, es zu benutzen.
Wenn ich durch die Trilogie durch bin, sage ich noch mehr zu diesen Büchern. Sie sind in England und besonders natürlich in Oxford ein ziemlicher Hit (inkl. Merchandising!).
Deutschsprachige Ausgabe:
Philip Pullman: Der goldene Kompass. Übersetzt von Wolfram Ströle und Andrea Kann. Carlsen, 1996.
Aktuell:
The Raven Boys von Maggie Stiefvater, das Weihnachtsgeschenk einer Freundin; von Christian Schärf Schreiben Tag für Tag, ein Band aus einer neuen Reihe des Duden-Verlags zum Thema Schreiben von den Wolfenbütteler Leuten um den Ortheil herum (hab ich auf der Buchmesse entdeckt, sie waren nominiert für “Schönste Bücher”); und als Nachtlektüre Schwerttänzer von Jennifer Roberson, Fantasy aus dem Dunstkreis von Marion Zimmer Bradley.
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Fantasy, Jan Morris, Jugendbuch, Krimi, Maj Sjöwall, Mary Scott, Patricia Wentworth, Per Wahlöö, Philip Pullmann, Reisebeschreibung, Roman | Kommentare deaktiviert
Dezember 2012
Verehrte Mit-Lesende!
Vor lauter anderen Aktivitäten schrumpfte meine Lese-Ausbeute noch weiter zusammen, und ich leide natürlich schon unter Entzugserscheinungen – aber es war ein volles und hektisches (schönes) Jahr, nur eben vielleicht nicht für das Lesen. Aber in Kürze gibt’s ja ein neues!
 L. C. Tyler: The Herring in the Library. 2010.
L. C. Tyler: The Herring in the Library. 2010.
Len Tyler habe ich dieses Jahr in Oxford kennengelernt – “kennen” ist natürlich übertrieben, ich hab ihn einen Vortrag halten hören und ein bißchen am Rande von größeren Gesprächsrunden mitgelauscht, in denen er dabei war. Seine Herring-Serie wurde sehr gelobt, weil witzig und mit Genre-Konventionen spielend; und als ich dann den Titel las, konnte ich nicht widerstehen.
Zum Buch: Das Buch gehört in die klassische Unterkategorie des “locked room puzzle”: Rob Muntham wird in der Bibliothek seines Landsitzes erdrosselt, und das während eines Abendessens, das er für eine sehr heterogene Runde von Bekannten gibt. Ehefrau und Gäste gelangen nur unter Anwendung von Gewalt in die Bibliothek. Während die Polizei sofort auf Selbstmord erkennt, drängt die Ehefrau den Schriftsteller Ethelred Tressider, der ebenfalls am Dinner teilnahm, den Mörder zu finden. Ethelred wird bei seinen Ermittlungen “gekonnt behindert” (Klappentext) von seiner Agentin Elsie Thirkettle.
So weit, so prima! Genau mein Ding! Doch beim Lesen beschlichen mich Zweifel. Entweder habe ich das Buch oder den Humor und die Anspielungen der Geschichte nicht verstanden, oder es ist eben doch nicht “mein Ding” gewesen. Weite Teile der Handlung werden nämlich erst von Ethelred und dann noch mal von Elsie (jeweils in Ich-Form) erzählt, wobei sich diese Berichte ziemlich unterscheiden (wir haben also gleich zwei unzuverlässige Erzählfiguren). Konventionelle Spannung kann bei so was nicht aufkommen, das ist klar; aber irgendwie ist diese Art des Erzählens diesmal nicht an mich rangegangen. Es war mir meist zu offensichtlich.
Erschwerend – sehr erschwerend! – kommt hinzu, daß wir ein großes Stück von Ethelreds neuem historischen Krimi, den er während seiner Ermittlung schreibt, mitlesen dürfen. An sich war ich immer ein großer Fan von “Buch im Buch”; das bin ich zwar immer noch, aber mittlerweile möchte ich die Bücher, von denen in Büchern die Rede ist, nicht mehr verbatim darin aufgeführt lesen. Ich bin immer öfter enttäuscht: Wenn in einem Roman von einem geheimnisvollen oder spannenden oder lustigen Buch die Rede ist, dann kann ich mir dieses Buch gut selbst vorstellen – und das, was ich mir vorstelle, ist immer viel geheimnisvoller, spannender oder lustiger als das, was dann tatsächlich da steht. Hier im Herring (und ich weiß nicht, ob das in den anderen Bänden der Serie auch so ist, dies ist der dritte Band) hatte ich deutlich das Gefühl, daß der eingeschobene Roman die eigentliche Handlung nur aufhält, und inwieweit das Manuskript zur Mordermittlung beiträgt, konnte ich nicht erkennen – es wäre aber auch too much gewesen, denn wir hatten ja schon zwei verschiedene Sichtweisen! (Ich muß unbedingt noch mal in den Meister des Jüngsten Tages von Leo Perutz reingucken – mir ist grad, als wäre das mit dem Buch im Buch dort ganz anders und viel besser gelungen!)
Wie bei der Stallwood neulich geschieht im Herring das, was genau vermieden werden soll: Statt daß die einzelnen Komponenten die Geschichte bereichern und verdichten, zerfransen und verdünnen sich alle Elemente gegenseitig.
(Ich sehe gerade, daß bislang nur der erste Band der Serie auf deutsch veröffentlicht wurde, und zwar unter dem Titel Im Tweedkostüm auf Mörderjagd.)
 Agatha Christie: The Pale Horse. 1961.
Agatha Christie: The Pale Horse. 1961.
Die Krimiautorin Ariadne Oliver ist eine von Christies weniger bekannten Serienfiguren; auch ich hab erst neulich überhaupt begriffen, daß es mehrere Bücher mit ihr als (Haupt-?)Figur gibt. Das fahle Pferd habe ich übrigens als erstes Buch von Christie gelesen, vor etwa dreißig Jahren, und seitdem auch nicht wieder. Jetzt fiel es mir auf Englisch in die Hand, und beim Wiederlesen hatte ich nun gar keine Bekanntheitsgefühle, was ich aber ganz gut fand.
Zum Buch: Im Pale Horse tritt die Oliver nur am Rande auf; der hauptsächliche Erzähler (“ich”) ist Mark Easterbrook, und es gibt ein paar Passagen, die von anderen Figuren in der dritten Person erzählt werden. Easterbrook schreibt ein historisches Sachbuch, aber da braucht er manchmal auch eine Pause. So geht er mal neugierig in eine der modernen Espressobars, die in Chelsea überall aus dem Boden schießen und in denen sich die hippen jungen Leute treffen. (Aus der zeitlichen Distanz jetzt sehr erheiternd!) Auf diese Weise erfährt er von plötzlichen Todesfällen – alle mit natürlichen Ursachen, aber auch alle mit großen Erbschaften verbunden … Nach einer Weile kommt ihm das komisch vor, so als ob es eine finstere Organisation gäbe, die unerwünschte reiche Verwandte beseitigt, natürlich gegen Honorar. Und als er bei einem Besuch auf dem Lande von drei Frauen hört, die im Dorf allgemein als Hexen anerkannt sind, beginnt er nachzuforschen. Kann man sozusagen spurlos auf Distanz töten? Und sind diese drei Frauen darin verwickelt? Zusammen mit einer Bekannten und Unterstützung durch einen befreundeten Kommissar wagt Easterbrook ein Experiment, um Klarheit in die Sache zu bringen, und nimmt an einer Seance teil.
The Pale Horse ist der Name des Cottages, in dem die drei Frauen leben, ein ehemaliger Gasthof; aber das “fahle Pferd” ist auch in der Apokalypse das Reittier des Todes, der mit Furcht und Krankheit einhergeht. Das paßt sehr gut bzw. ist von Christie gut ausgesucht, und mehr will ich jetzt gar nicht sagen, denn ich fand es schon sehr spannend zu lesen! Clever ist auch die Seance gestaltet, überhaupt die Beschreibung der “Hexen” – zu den traditionellen Elementen läßt Christie ganz moderne treten, zum Beispiel Elektrizität. Je mehr ich von ihr (wieder-)lese, desto größer wird meine Hochachtung vor ihr als Meisterin des Schreibens! Wie üblich, habe ich auch nur den Punkt zu bemängeln, daß relativ wenig gegessen und getrunken wird. Christie benutzt Mahlzeiten eher als Zeitangaben, nicht als sinnliche Elemente. Aber man kann schließlich nicht alles haben!
Deutsprachige Ausgabe:
Agatha Christie: Das fahle Pferd. Übersetzt von Margret Haas (1994 überarbeitet). Scherz, 1962.
Aktuell:
… studiere ich meine diversen Bücherlisten, um mir für das kommende Jahr ein Menü mit mehr Abwechslung zusammenzustellen!
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Agatha Christie, Krimi, Len Tyler | Kommentare deaktiviert