November 2012
30. November 2012
Liebe Mit-Reisende in Sachen Buch,
der Monat ist an mir vorbeigeflutscht, so schnell konnte ich gar nicht gucken! Und nun ist Ultimo … nicht daß ich viel zum Lesen gekommen wäre. Aber ein paar Bücher gibt es doch.
 Barbara Pym: Some Tame Gazelle. 1950.
Barbara Pym: Some Tame Gazelle. 1950.
Sie gilt als Jane Austen des 20. Jahrhunderts, nachdem sie “wiederentdeckt” wurde und nach 16 Jahren unfreiwlliger Veröffentlichungspause (kein Verlag wollte sie, man hielt ihre Bücher für altmodisch) noch ein paar Jahre diesen wohlverdienten Ruhm selbst erleben konnte (und auch noch Neues veröffentlichen). Doch all das hat ihr wohl wenig genützt, denn ich habe den Eindruck, daß sie schon wieder in Vergessenheit geraten ist; und ihr Werk ist seit einem vielversprechenden Start auch nicht weiter ins Deutsche übersetzt worden. Vermutlich liefen die Bücher nicht so gut; was meiner Meinung nach daran lag, daß sie falsch beworben wurden. Pym ist eben keine “gehobene Frauenunterhaltung”, sondern Weltliteratur.
Dabei ist die Pym (1913-1980) so eine tolle Schriftstellerin! In ihren Büchern passiert wenig bis nichts. Meist handeln sie von Frauen, die verheiratet oder unverheiratet ihre Umgebung und vor allem die Menschen darin beobachten. Wir sind ZeugInnen ihrer Gedanken, und die sind von einer Hellsichtigkeit, wie sie eben auch Jane Austen hatte. Nur daß Pym natürlich ihre eigene Zeit betrachtet, nämlich das England vor und nach dem zweiten Weltkrieg. Und englischer als bei ihr geht es nicht, meist in dörflichem Umfeld, aber durchaus auch in London (nur fühlt sich das bei ihr wenig großstädtisch an). All das in einer gepflegten Sprache, die keine Mätzchen braucht, um zu beschreiben, und begleitet von jeder Menge Humor – von der leisen Sorte, aber ich hab auch oft laut gelacht beim Lesen.
Zum Buch: Some Tame Gazelle ist Pyms erster veröffentlichter Roman, geschrieben wohl schon während und kurz nach ihrem Studium (in Oxford am St Hilda’s College), weswegen man beim Lesen noch das „goldene Zeitalter“ Englands zwischen den Weltkriegen erlebt. Die Schwestern Belinda und Harriet, beide über fünfzig und unverheiratet, leben zusammen in einem Häuschen auf dem Dorf. Harriet ist ein großer Fan von Hilfsgeistlichen, die sie gern einlädt und mit gutem Essen und Geschenken verwöhnt. Belinda liebt den Archidiakon des Dorfes, und das schon seit ihrem gemeinsamen Studium; leider hat er sich für eine andere Frau entschieden, vielmehr hat die ihn sich energisch unter den Nagel gerissen. Dennoch bewahrt Belinda sich ihre Zuneigung zu ihm. Bei Beginn des Buches soll der neueste Hilfsgeistliche zu den beiden Schwestern zum Essen kommen; den Schluß bildet seine Hochzeit nach einigen Monaten. Dazwischen entfaltet sich das englische Dorfpanorama in seiner ganzen Pracht, mit Kirchenfesten, Gesellschaft, Kleidung, Garten, Essen, Gesprächsthemen, all den schrulligen Dorfbewohnern …
Pym zeichnet liebevoll und aus wechselnder Perspektive (also die Erzählenden wechseln, manchmal sehr flott – meist jedoch aus Belindas Sicht) nach, wie sich dieses dörfliche Menuett abspielt, und man gewinnt sie irgendwie alle lieb, welche Macken sie auch haben. Und Belindas Stimme ist zwar naiv, aber die Autorin selbst ist es in keinster Weise; sie ist jedoch auch niemals gehässig. Und trotz der wenigen “Action” kommt durchaus Spannung auf – wird Harriet den Heiratsantrag doch annehmen? Wird Belinda es tun?
Rundum ein Lesevergnügen, und natürlich nicht ins Deutsche übersetzt.
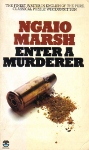 Ngaio Marsh: Enter a Murderer. 1935.
Ngaio Marsh: Enter a Murderer. 1935.
Von der Marsh habe ich bislang nur wenig gelesen, sie ist ja auch hierzulande weit weniger bekannt als die anderen drei der vier “Krimiqueens”, wie sie in Großbritannien immer tituliert werden (Christie, Sayers, Allingham und Marsh), und deshalb ist dieser Ehrentitel für uns auch ziemlich schwer verständlich. Für mich sowieso, denn es gab zur gleichen Zeit noch haufenweise andere Autorinnen, die ebenso gut, wenn nicht besser waren … Nun ja.
Zum Buch: Dies ist der zweite Band aus Marshs Serie mit Chief Detective Inspector Roderick Alleyn von Scotland Yard. Hier ist er noch ziemlich farblos, muß ich sagen – ja geradezu widersprüchlich als Figur. Jedenfalls nimmt ihn ein Freund, der als Journalist auch Theaterkritiken schreibt, mit in eine Vorstellung, und prompt wird einer der Schauspieler auf offener Bühne ermordet. Wie gut, daß Alleyn alles gesehen hat! Problematisch ist nur, daß man zwar weiß, wer die Pistole abgefeuert hat – das sieht nämlich das Stück an der Stelle so vor -, nur hat er das in dem Glauben getan, er schösse gar nicht in echt … Das riecht danach, als habe man ihn benutzt. So ermitteln Alleyn und seine Mannen intensiv im Theater, befragen alle, stellen die Szene nach, und langsam ermüdete meine Aufmerksamkeit bei all den Wiederholungen. Wie es sich für einen klassischen Rätselkrimi gehört, wurden so ziemlich alle (außer Alleyn) verdächtigt und wieder entlastet, bis niemand mehr übrig blieb – und dann war es natürlich doch einer der vorher Verdächtigten.
Die Marsh war eine Theaterfrau, das hat man in diesem Krimi mehr als deutlich gemerkt. Aber auch viele ihrer anderen Bücher spielen in diesem Milieu (es wird auch musiziert, gemalt und getanzt). In ihrer Heimat Neuseeland hat sie sozusagen eigenhändig die Theaterszene überhaupt erst mal in Schwung gebracht, und dafür wird sie dort auch immer noch geehrt. Ihre Krimis spielen zumeist in England, es gibt aber auch ein paar bei den Kiwis (insofern paßt das ja auch gut zur diesjährigen Buchmesse), und ihr Vorname ist aus der Maorisprache. Außerdem hatte die Marsh ein Faible für wirklich ausgefallene Mordmethoden; das ist dann so skurril, daß es schon wieder gut ist. Und wer mal sehen will, wie ein total klassischer (und weit verbreiteter) Rätselkrimi funktioniert, ist mit diesem prima bedient.
Deutschsprachige Ausgabe:
Ngaio Marsh: Ein Schuß im Theater. Übersetzt von Lola Humm-Sernau. Scherz, 1957.
 Emma Lathen: By Hook or by Crook. 1975.
Emma Lathen: By Hook or by Crook. 1975.
Wir wechseln das Land, aber nicht das Genre. Emma Lathen war das Pseudonym zweier Studienfreundinnen, die über viele Jahre hinweg Krimis geschrieben haben, die quasi alle Bereiche des US-amerikanischen Wirtschaftslebens abdecken. Sie wurden dafür gelobt, wie gut sie die verschlungenen Pfade der Wirtschaft beschreiben und erklären können; ich muß jedoch gestehen, daß ich da schon Besseres gelesen habe (nicht zuletzt von Dick Francis).
Zum Buch: John Putnam Thatcher arbeitet in höherer Position bei der Privatbank Sloan Guaranty Trust, einem “global player” in Finanzfragen. Ein Kollege von ihm betreut ein Teppichimperium und zieht Thatcher hinzu, als die Sache unübersichtlich wird: es geht um feindliche Übernahme innerhalb der Teppichhandelsfirma, um Testamente, um Identitäten, und natürlich um viel Geld. Anrührend heutzutage, wie die Geschicke der Firma, die viel in Persien kauft und deren Inhaberfamilie auch von dort stammt, ab dem zweiten Weltkrieg beschrieben werden und wie sie „heute“ (Mitte der Siebziger) in Persien herumreisen auf der Suche nach den schönsten Stücken …
Doch, das hatte schon was. Und ich fand auch diese Testamentssache klasse – verwickelter hätte man es sich kaum ausdenken können! Allerdings hat mich schon nach wenigen Seiten genervt, daß bei jeder wörtlichen Rede dabeistand, wie die gemeint war. Mag sein, daß manche das mögen oder gar brauchen oder daß es vielleicht auch ein Zeitphänomen ist, aber ich möchte, daß alle AutorInnen ihrem Text so weit vertrauen, daß er für sich allein sprechen kann und nicht jeder Pieps eine Gebrauchsanleitung mitgeliefert bekommen muß. Ein-, zweimal so was ist okay, aber nicht ständig und das ganze Buch hindurch.
Deutschsprachige Ausgabe:
Emma Lathen: Kette und Schuß. Übersetzt von Ute Tanner. Ullstein, 1975.
 Charlotte MacLeod: The Family Vault. 1979.
Charlotte MacLeod: The Family Vault. 1979.
Wir bleiben im Land und in der Zeit, eigentlich auch im Untergenre – die Macleod gilt als „America’s Agatha Christie“ (steht so auf meinem Exemplar). Und auch wenn dieses Buch, ja die diese ganze Serie um Sarah Kelling im Boston der 1970er spielt, so fühlt es sich doch an, als ob wir von einem englischen Landhaus zum anderen lesen …
Zum Buch: Dies ist der erste Band mit Sarah Kelling, und er hat nichts mit dem Hitchcock-Film zu tun, wohl aber mit Gräbern und VIEL Familie. Ein verflossener Großonkel soll in der Familiengruft beigesetzt werden, doch als sie zur Vorbereitung nach vielen Jahren erstmals geöffnet wird, liegt drin auch ein Skelett, das dort ganz klar nichts zu suchen hat – wie sich herausstellt, gehörte es einer halbseidenen Sängerin, die ihre Zähne mit Rubinen verzieren ließ. Sarah ermittelt anfangs eher zufällig und versehentlich, dann aber immer motivierter, denn sie fürchtet, daß ihr eigener Mann dahinterstecken könnte.
Definitiv nette Lektüre! So richtig zum Schmökern (auch wenn ich hin und wieder über Sarahs weniger intelligente Einfälle und Handlungen hinwegsehen mußte), mit allem Drum und Dran, noch mehr Leichen (hübsch im Off gemordet), familiären Verwicklungen, wertvollem Geschmeide, einer zarten Liebesgeschichte … genau das Richtige für graue Wintertage. Ich schließe mich Margaret Maron an, die für diese Ausgabe das Vorwort geschrieben hat und darin sagt: “Ich beneide euch glühend, wenn ihr jetzt das Buch zum ersten Mal lest! Ich wünschte, das könnte ich auch wieder.”
Deutschsprachige Ausgabe:
Charlotte MacLeod: Die Familiengruft. Übersetzt von Daniela Hermes und Achim Schückes. Dumont, 1988.
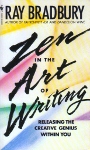 Ray Bradbury: Zen in the Art of Writing. 1990.
Ray Bradbury: Zen in the Art of Writing. 1990.
Das ist ein Sammelband mit seinen Aufsätzen und Vorworten aus diversen Jahren. Bradbury ist unlängst von uns gegangen, aber er hat ein umfangreiches Werk zurückgelassen, unter anderem mehr als 300 Stories und ein paar Romane (Fahrenheit 451) und allerlei anderes auch noch, was mir nicht alles gefällt, aber es gibt jedenfalls viel zu entdecken. Er mäandert so zwischen Krimi und Science Fiction und Horror herum, daß man ihn überhaupt nicht auf ein bestimmtes Genre festlegen kann.
Zum Buch: Es ist Buch über das Schreiben, aber kein Schreibratger, obwohl Bradbury schon ein paar Ratschläge gibt. Es ist ein sehr persönliches Buch und wird zu einigen sprechen, zu anderen wahrscheinlich nicht. Ich glaube aber, es zu lesen und darüber nachzudenken lohnt sich – selbst für diejenigen, die gar nicht vorhaben zu schreiben.
Deutsprachige Ausgabe:
Ray Bradbury: Zen in der Kunst des Schreibens. Übersetzt von Kerstin Winter. Autorenhaus, 2003.
Aktuell:
Einige Krimis und dies und das – und die ersten Weihnachtskataloge, zum Beispiel „Die moderne Hausfrau“!
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Barbara Pym, Charlotte MacLeod, Emma Lathen, Krimi, Ngaio Marsh, Ray Bradbury, Roman, Schreibbuch | Kommentare deaktiviert