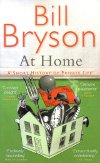August 2011
Werte Leserinnen und Leser,
hier die Ausbeute des Monats.
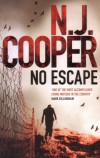 N. J. Cooper: No Escape. 2009.
N. J. Cooper: No Escape. 2009.
Mal ein Showdown, der nicht aus körperlichem Zweikampf besteht, sondern sehr intellektuell ist. Und mir hat auch gefallen, wie im Laufe des Buches die Insel für mich Realität geworden ist (ich hab aber auch bei Google und Wikipedia nachgesehen). Im Vergleich zu dem ziemlich langatmigen Cyteen (siehe Juli 2011) voller intensiver Selbsterforschung der Figuren war No Escape gradezu atemlos und vielleicht ein bißchen oberflächlich; so was hat aber auch mit der Erzählperspektive zu tun. Cherryh schreibt ziemlich streng in dritter Person, bis fast hin zu Stream of Consciousness; bei Cooper ist die personale Perspektive etwas distanzierter.
Ich habe die Autorin vor einigen Jahren in Oxford kennengelernt und mag sie als Mensch sehr gut leiden. Sie ist souverän und auch sehr herzlich, hoch gebildet, ohne aufdringlich zu sein, und mit einer wirklich tollen Stimme und Sprechtechnik. Natasha Cooper (eins ihrer mindestens drei Pseudonyme) hat Thriller, historische Romane und Detektivkrimis geschrieben. Als N. J. Cooper und mit No Escape beginnt sie eine neue Serie, mit der sie in Großbritannien derzeit erfolgreich ist.
Zum Buch: Die forensische Psychologin Karen Taylor reist auf die Isle of Wight, um dort für ihre Doktorarbeit den lebenslang inhaftierten Mehrfachmörder Spike Falconer, der scheinbar grundlos eine vierköpfig Urlauberfamilie beim Picknick erschossen hat, zu interviewen. Sie wird schnell kontaktiert von Detective Charlie Trench, der davon überzeugt ist, daß dieser Mörder noch weitere Opfer auf dem Gewissen hat. Karen fallen in den Interviews jedoch ein paar Ungereimtheiten auf, und sie versucht, weitere Informationen über Spikes Familie zu finden. Dabei gerät sie in Konflikt mit den besseren Kreisen von Wight. Zusätzlich muß sie sich auch noch mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, die durch ihre Recherche wieder auflebt, nämlich ihrem tödlich verunglückten Ehemann, überhaupt mit ihrer Beziehung zu Männern (dem aktuellen Freund und natürlich auch dem Polizisten).
Deutschsprachige Ausgabe:
Natasha Cooper: Unerbittlich ist der Tod. Übersetzt von Ulrike Laszlo. Weltbild, 2010.
 Sheila Radley: The Chief Inspector’s Daughter. 1981.
Sheila Radley: The Chief Inspector’s Daughter. 1981.
Eine Freundin meiner Mutter mistet ihre Bücher aus, weil ihre Regale zusammengebrochen sind, und ich bekomme die Krimis verabfolgt, besonders die auf Englisch. So erreichte mich dieses Buch von einer englischen Autorin, die mir bislang unbekannt war. Sheila Robinson (*1928), so ihr richtiger Name, veröffentlichte als Sheila Radley von 1978 bis 1994 neun Krimis mit dem Inspector Douglas Quantrill, der im ländlichen England ermittelt. Solide Kost und lesenswert, würde ich nach Lektüre dieses zweiten Teils der Serie sagen, sehr englisch und cozy, aber behutsam modernisiert. Außer diesen Krimis erschienen von Radley 1998 ein historischer Roman, der in England um 1530 spielt, und unter dem Pseudonym Hester Rowan drei Romantic Thrillers (1976-1978). Ein Teil der Krimis und der historische Roman sind ins Deutsche übersetzt worden.
Zum Buch: Gefallen hat mir, daß das Opfer eine Schriftstellerin ist, die zwar großes Talent hat, aber ihr Geld mit Liebesromanen verdient – unanständig viel Geld für solchen Schund, wie einer der Verdächtigen (ebenfalls Schriftsteller, aber ein „richtiger“) meint. Hübsch modernisiert auch ein Gärtner als Verdächtiger. Und natürlich gibt es auch eine Liebesgeschichte in diesem Krimi. Der Ort des Showdowns, ein großes „Mittelalter“-Festival, war mir natürlich sehr vertraut, und ich fand die Schilderung vor allem deshalb interessant, weil die Mittelalter-Reenactment-Bewegung erst sehr viel später richtig in Schwung gekommen ist, sowohl in England als auch bei uns. An den Mörder erinnere ich mich übrigens jetzt nicht mehr! Ich gebe auch zu, daß ich viel dringender wissen wollte, ob und wie die titelgebende Tochter mit dem Assistenten des Chief Inspectors zusammenkommt, was zwar ihre Eltern gern wollen, sie und der junge Mann jedoch eher nicht.
Deutschsprachige Ausgabe:
Sheila Radley: Viele Neider sind der Schönen Tod. Übersetzt von Ute Tanner. Scherz, 1983.
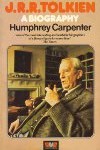 Humphrey Carpenter: J. R. R. Tolkien. A Biography. 1977.
Humphrey Carpenter: J. R. R. Tolkien. A Biography. 1977.
Wiedergelesen, wie schon öfter. Es war wohl auch eine der ersten Biographien überhaupt (nicht nur von Tolkien), die ich gelesen habe, und ich finde sie nach wie vor vorbildlich. Carpenter starb vor sechs Jahren, was ich erst jetzt bei der Recherche entdeckt habe. Er schrieb mehrere Biographien (zum Beispiel über die Inklings und andere Autoren, aber auch über Benjamin Britten und Spike Milligan – den fand ich ja mal einen schrägen Vogel!), über Kinderliteratur und fürs Radio, außerdem spielte er privat in einer Jazzband.
Zum Buch: Carpenter, der Tolkien noch persönlich gekannt und bei ihm Vorlesungen gehört hat, bringt uns den Menschen und den Sprachwissenschaftler nahe, und er schildert auch Tolkiens Liebe zur Sprache in all ihren Erscheinungsformen so innig, daß man selbst sofort Linguistik studieren möchte (ein Effekt, den Tolkiens Vorlesungen übrigens auf eine Menge Studierende hatten). Natürlich erläutert Carpenter ausführlich die Idee und Entwicklung von Tolkiens erzählerischem Werk, und das auf eine Weise, die bestimmt auch für Nicht-Tolkien-Fans die literarische Bedeutung und den Publikumserfolg erhellt.
Deutschsprachige Ausgabe:
Humphrey Carpenter: J. R. R. Tolkien, eine Biographie. Übersetzt von Wolfgang Krege. Klett-Cotta, 1979.
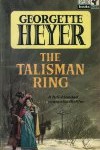 Georgette Heyer: The Talisman Ring. 1936.
Georgette Heyer: The Talisman Ring. 1936.
Das war eine Nachtlektüre von mir, vermutlich erschien es mir deshalb so langatmig (wenn man nämlich immer nur zwei, drei Seiten mit müden Augen liest).
Zum Buch: Es ist irgendwie ein historischer Krimi (aber mindestens zur Hälfte ein Liebesroman), und es geht irgendwie um das im Titel genannte Schmuckstück, das irgendwie einen Mord beweist oder vielmehr die Unschuld des eigentlichen Besitzers … ahem, also die Handlung ist recht schlicht gestrickt und der wahre Täter von Anfang an klar, jedenfalls für uns versierte Krimikundige. Dennoch hat es Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen, denn es besteht zum größten Teil aus dem, was die Heyer am besten kann: witzige Dialoge.
Am Rande: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet als Übersetzerin überwiegend Emi Ehm, ohne weitere Angaben, aber einmal auch Emil Ehm; „Emil“ hat eine persönliche Akte, während die wesentlich fleißigere „Emi“ nichts hat, obwohl sie neben Heyer auch Colette und tausend andere bekannte Namen übersetzt hat … Leider finde ich im Internet keine Angaben zu ihrer Person. Würd mich ja mal interessieren. Der deutsche Titel ist übrigens irreführend, auch wenn ich gestehe, ihn spannender zu finden als etwa „Verlobung zu viert“.
Deutschsprachige Ausgabe:
Georgette Heyer: Verlobung zu dritt. Übersetzt von Emi Ehm. Zsolnay, 1968.
Nina George: Die Mondspielerin. Knaur, 2010.
Schönes Buch und zu Recht mit dem DeLia 2011 ausgezeichnet! Das ist nun alles nicht unbedingt meine typische Lektüre, aber ich kenne ja die Autorin und ihr übriges Werk ein bißchen und war daher neugierig. Mit der Mondspielerin hatte ich jedenfalls sehr viel Vergnügen, hab gelacht und war bewegt, hab was gelernt (unter anderem über bretonische Küche und Erotik) und bin froh, daß ich es gelesen habe!
Zum Buch: Eine schon etwas ältere (deutsche) Frau blickt auf ihr Leben zurück und findet es nicht lebenswert. Deshalb will sie sich in Paris von einer Seinebrücke stürzen. Sie wird gegen ihren Willen gerettet und beschließt nun, sich an der bretonischen Küste im Atlantik zu ertränken. Durch eine Verwechslung wird sie als Köchin eingestellt und findet in dem bretonischen Dorf nicht nur Freunde, sondern auch Verehrer. Daher schiebt sie den Freitod immer weiter auf – bis ihr Ehemann sie wiederfindet.
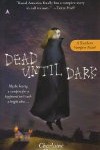 Charlaine Harris: Dead Until Dark. 2001. / Living Dead in Dallas. 2002.
Charlaine Harris: Dead Until Dark. 2001. / Living Dead in Dallas. 2002.
Den ersten Band dieser Reihe bekam ich vor einigen Jahren von einer Freundin, die sich mit Vampiren nicht so anfreunden konnte, aber die Autorin oder vielmehr ihr Werk kenne ich schon länger, weil sie ja auch eine Story in Mord zwischen Messer und Gabel hat.
Zu den Büchern: Weil mir nun eine andere Freundin geradezu hymnisch von der Serie vorschwärmte, hab ich Dead Until Dark noch mal gelesen und finde es weiterhin unterhaltsam, spannend und sexy. Man muß natürlich Vampire im Krimi zulassen können, und in diesem Fall nicht nur Vampire, sondern auch allerlei weiteres übernatürliches Volk. Alle leben, so die Prämisse der Serie, einigermaßen friedlich mit normalen Menschen (in der Serie vor allem in den Südstaaten der USA) zusammen und haben auch so ihre normalen Probleme, weswegen es naheliegt, eine Kellnerin – Sookie Stackhouse – als Amateurermittlerin in normalen und paranormalen Fällen loszuschicken. Nach ein paar Folgebänden hat das auch das US-amerikanische Fernsehen begriffen (True Blood), was wiederum der Buchserie zugutekam, also hoffentlich zumindest umsatzmäßig. Im Gegensatz zum ersten Band fand ich den zweiten reichlich mau, aber das ist ja oft so in Serien, da muß man einfach durchhalten. Jedenfalls liegt der dritte Band schon parat.
natürlich Vampire im Krimi zulassen können, und in diesem Fall nicht nur Vampire, sondern auch allerlei weiteres übernatürliches Volk. Alle leben, so die Prämisse der Serie, einigermaßen friedlich mit normalen Menschen (in der Serie vor allem in den Südstaaten der USA) zusammen und haben auch so ihre normalen Probleme, weswegen es naheliegt, eine Kellnerin – Sookie Stackhouse – als Amateurermittlerin in normalen und paranormalen Fällen loszuschicken. Nach ein paar Folgebänden hat das auch das US-amerikanische Fernsehen begriffen (True Blood), was wiederum der Buchserie zugutekam, also hoffentlich zumindest umsatzmäßig. Im Gegensatz zum ersten Band fand ich den zweiten reichlich mau, aber das ist ja oft so in Serien, da muß man einfach durchhalten. Jedenfalls liegt der dritte Band schon parat.
Charlaine Harris startete 1981 und 1984 mit zwei Einzelkrimis und hat inzwischen insgesamt vier Krimiserien; die erste (Aurora Teagarden, ab 1990), eher cozy, wird grad erst ins Deutsche übersetzt; mit der zweiten, in der eine Putzfrau mit Vergangenheit ermittelt (Lily Bard, 1996-2001), hat die Autorin abgeschlossen; die dritte ist diese Vampirserie; und die vierte, um eine Hellseherin (Harper Connelly, ab 2005), pausiert gerade.
Deutschsprachige Ausgabe:
Charlaine Harris: Vorübergehend tot. / Untot in Dallas. Beide übersetzt von Dorothee Danzmann. Feder & Schwert, 2004.
Aktuelle Lektüre:
Immer noch die Heidenreich, ferner was über English Teatime und als Nachtlektüre Kästner.
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Biographie, Charlaine Harris, Georgette Heyer, Humphrey Carpenter, J. R. R. Tolkien, Krimi, N. J. Cooper, Nina George, Roman, Shelia Radley | Kommentare deaktiviert
Juli 2011
Werte Lesende!
Viel gelesen hab ich diesen Monat nicht, jedenfalls sieht es nicht so aus – nur vier Bücher, zwei davon allerdings ziemlich dick.
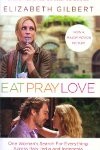 Elizabeth Gilbert: Eat Pray Love. 2006.
Elizabeth Gilbert: Eat Pray Love. 2006.
Ich fand und finde den Titel gut; allerdings hatten mich die Besprechungen zu Buch und Film eher abgeschreckt. Jetzt hatte ich es second hand gefunden und dachte, guckst doch mal rein. Es liest sich ganz flott. Manchmal ging mir das schon auf den Keks, wie die Autorin doch immer wieder Selbstzweifel hegte, aber bei anderen Leuten ist das ja immer nervig. Ihre Schilderungen von Italien und italienischem Essen waren sehr anschaulich; mit ihren Erfahrungen in einem indischen Ashram kann vermutlich nur jemand was anfangen, der sich schon ähnlich mit dieser Materie befaßt hat; und was sie auf Bali wollte, wußte sie selbst nicht so recht, und genauso liest es sich dann auch. Aber es ist halt kein Roman, und auch wenn sie zufällig am Ende wieder einen Mann findet, in den sie sich verliebt und mit dem es dann auch wirklich gut klappt (siehe auch ihr neuestes Buch über die Ehe!), so ist das eben das wilde, unberechenbare reale Leben, das mitunter kitschiger ist als der kitschigste Roman.
Interessant waren für mich die Anmerkungen auf einer Website zu dem Umstand, daß neuerdings unheimlich viele Frauen auf der Suche nach sich selbst den kleinen Ort auf Bali fluten, in dem Gilbert war. Offenbar gab es dort vorher schon reichlich Selbstfindungstouristinnen (inklusive Abenteuerbatiken und Buchhäkeln), aber jetzt hat sich ihre Zahl vervielfacht. Eine Kommentatorin meint dazu: „Sie können noch so viel Zeit dort verbringen und werden höchstens lernen, daß sie nicht Elizabeth Gilbert werden können …“ Genau. Jede/r muß den eigenen Weg finden. Ich wollte noch nie nach Bali, und was Gilbert darüber schreibt, überzeugt mich noch weniger davon, dorthin zu reisen. Daß Bali so friedlich wär, ist offenbar eine clevere Marketingidee der Indonesier; bis in die 1960er haben sie sich dort genauso abgeschlachtet wie woanders auch. Und die Menschen sind ebenso Menschen wie in allen anderen Teilen dieser Welt.
Zum Buch: Grob gesagt, erzählt die Autorin ein Jahr aus ihrem Leben, das sie je zu einem Drittel in Italien, in Indien und auf Bali verbracht hat. Damit wollte sie ihre schweren Depressionen loswerden, die unter anderem vorher zu ihrer Scheidung und einer weiteren katastrophalen Liebesgeschichte geführt hatten.
Deutschsprachige Ausgabe:
Elizabeth Gilbert: Eat, pray, love oder eine Frau auf der Suche nach allem quer durch Italien, Indien und Indonesien. Überstzt von Maria Mill. Bloomsbury, 2006.
Natalie Goldberg: The Great Failure. 2004.
Das fand ich ein schwieriges Buch. Es wußte nämlich auch nicht so recht, wohin mit sich. Ich hab Writing Down the Bones und Wild Mind sehr gern gelesen und kehre auch immer wieder mal dahin zurück; aber ich wollte auch was über die Autorin wissen, das über das hinausgeht, was auf ihrer Website steht.
Zum Buch: Im Wesentlichen beschäftigt sich Goldberg in diesem Buch mit ihren Illusionen – über ihren Vater, von dem sie sich nicht richtig wahrgenommen fühlte (ich hab die ganze Zeit gedacht, er hätte sie mißbraucht, aber das steht nirgends im Buch und war wohl auch nicht so), und über ihren Zen-Lehrer, der nicht so zolibatär lebte, wie sie gedacht hatte. Was sie da nun genau aus der Spur gebracht hat, habe ich nicht verstanden, und was sie mit „Versagen“ eigentlich meint, konnte ich auch nicht herausfinden. So bleibt das Buch irgendwie zerfasert und unentschlossen.
(noch keine deutschsprachige Ausgabe)
Jetzt, wo ich damit durch bin, kann ich nur sagen: Es ist zu kurz. Beim Lesen sind mir noch ein Haufen weitere (Alltags-)Themen und Sachen eingefallen, deren Geschichte ich gern lesen würde. Und spannend fände ich bei vielem auch einen kulturgeographisch (und -historisch) weiter gefaßten Vergleich. Neulich las ich woanders zufällig, daß die Geschichte der Topfpflanze als Hausgenossin im Mittelalter beginnt. Und ich erinnere mich nur allzu lebhaft daran, mit welcher Begeisterung ich selbst vor einigen Jahren die Geschichte des Büros und des Büromaterials erforscht habe – leider durfte ich dann nur 2700 Zeichen dazu schreiben, aber ich hatte so einen Spaß allein schon beim Recherchieren! Bryson offenbar auch, und er springt so unangestrengt von einem Ding zum nächsten; und er hat wirklich die Gabe, Verbindungen und Muster zu sehen und sie auch noch verständlich und oft amüsant zu präsentieren.
Zum Buch: Bryson geht durch sein Wohnhaus in Norfolk in England und betrachtet Raum für Raum, wie sich angesichts der industriellen Revolution die Alltagskultur seit Mitte des 19. Jahrhunderts in technischer und soziologischer Hinsicht entwickelt hat. Wie wurden (Wohn-)Häuser gebaut und eingerichtet, wie wurden sie genutzt, welche Gegenstände nahm man täglich in die Hand und wozu, welche Menschen lebten wie zusammen? Unterhaltsam, manchmal bissig, plaudert Bryson darüber, wie sich Weltgeschichte in unserer unmittelbaren Umgebung niederschlägt.
Deutschsprachige Ausgabe:
Bill Bryson: Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge. Übersetzt von Sigrid Ruschmeier. Goldmann, 2011.
Diesen Science-Fiction-Roman habe ich vor zwanzig Jahren schon mal auf Deutsch gelesen und hatte nur noch eine vage Erinnerung daran, daß ich damals mit dem Buch nicht recht klargekommen bin, obwohl die Autorin zu meinen großen Lieblingen gehört. Jetzt fand ich das Werk antiquarisch auf Englisch und machte einen erneuten Anlauf. Auch wenn das große Paperback nur 680 Seiten hat, in Wirklicheit sind es vermutlich doppelt so viele, denn die Schrift ist klein und der Satzspiegel sozusagen vollgestopft. Aber ich glaube, es liegt am Thema und an den Figuren, daß die Sache immer noch nicht so an mich rangeht.
Zum Buch: Es geht im wesentlichen um wirtschaftspolitische Machtspiele. In einer ferneren Zukunft hat sich die Menschheit in diverse Sonnensysteme verbreitet (am interessantesten fand ich die Einleitung mit “was bisher geschah”, gibt’s ähnlich auch online) und politisch auseinanderentwickelt. In einer dieser neuen Gesellschaften sind geklonte Menschen üblich, die zum größten Teil auch psychologisch programmiert für bestimmte Aufgaben sind. Die Firma, die das Fast-Monopol auf diese Technologie und Forschung hat, ist ein Familienunternehmen. Innerhalb des Unternehmens und auch außerhalb kommt es zu jeder Menge Reibereien, was dazu führt, daß die Unternehmensleiterin ermordet wird. Nun wird ein Klon von ihr hergestellt, und sie versuchen, dieses Kind genau denselben Einflüssen auszusetzen, damit hinterher dieselbe Persönlichkeit entsteht (Psychogenese). Erzählt wird aus der Sicht von mehreren Figuren, unter anderem diesem Klonkind (das fand ich am zweitspannendsten), und über einen Zeitraum von etwa zwanzig Jahren. Leider blieben mir alle Figuren emotional fremd, ich konnte eigentlich auch nicht herausfinden, wer nun der Held der Geschichte ist, auf dessen Seite ich stehe beim Lesen. Übrigens bleibt auch der Mord letztlich ungeklärt, weswegen es auch einen Folgeband gibt. Man muß die Autorin wirklich schon sehr mögen und sich für Hardcore-SF und Wirtschaftspolitik interessieren, um das Buch überhaupt erst mal in die Hand nehmen zu können.
Deutschsprachige Ausgabe:
C. J. Cherryh: Cyteen (Der Verrat / Die Wiedergeburt / Die Rechtfertigung). Übersetzt von Michael K. Iwoleit. Heyne, 1990, drei Einzelbände. (1998 in einem Band unter dem Titel Geklont erschienen.)
Aktuelle Lektüre:
Immer noch die Heyer, dazu angefangen Der Wurm Ouroboros, ein englischer Fantasyklassiker von 1926 – sehr zäh zu lesen. Und aufm Klo Else Stratmann. Mehr zu all diesen demnächst.
Kategorien: Erlesenes | Schlagwörter: Autobiographie, Bill Bryson, C. J. Cherryh, Elizabeth Gilbert, Kulturgeschichte, Natalie Goldberg, Science Fiction | Kommentare deaktiviert